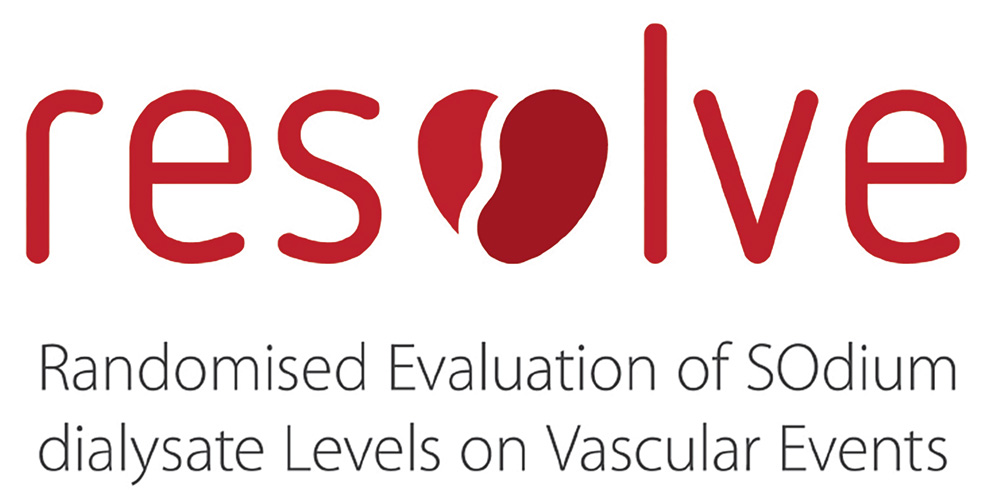Förderungen von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
Gemeinsam gegen Hirnmetastasen im deutsch-japanischen Team – Barrierefunktion der Blut-Hirn-Schranke optimieren
Bei jedem vierten Menschen mit einer fortgeschrittenen Krebserkrankung dringen die Tumorzellen ins Gehirn und führen zu Metastasen. Besonders häufig betroffen sind Frauen mit Brustkrebs. Die Symptome treten zwar erst mehrere Monate oder Jahre nach der Erstdiagnose eines Mammakarzinoms auf, die Tumorzellen durchdringen jedoch schon im frühen Erkrankungsstadium die Blut-Hirn-Schranke, indem sie die entzündlichen Signalwege in den Blutgefäßzellen aktivieren, wodurch ihr Eindringen ins empfindliche Hirngewebe erleichtert wird.
Bislang gab es keine Möglichkeit, die Invasion von metastasierenden Krebszellen ins Gehirn wirkungsvoll zu verhindern. Das möchte Prof. Dr. Carola Förster, die am UKW die Abteilung Experimentelle Anästhesiologie leitet, mit ihrem interdisziplinären und internationalen Team, das sich aus erfahrenen Neuroonkologen, Biochemikern, Zell- und Molekularbiologen sowie technischen Assistenten zusammensetzt, ändern. Da Carola Förster bereits über langjährige Kontakte zu ausgewiesenen Spezialisten in Japan verfügt, hat sie von der DFG einen Grant (Fo 315/5-1) erhalten, um den Austausch zu fördern und die internationale Zusammenarbeit zu etablieren. Sie möchten zum Beispiel in In-vitro- und In-vivo-Modellen untersuchen, wie sie mit einer völlig neuartigen endokrinen Kombinationstherapie die Blut-Hirn-Schranke gegen den Durchtritt von metastasierenden Brustkrebszellen abdichten können. Zum Auftakt des internationalen Kooperationsprojekts „Das Gehirn vor Metastasen schützen“ reiste Carola Förster mit ihrem Team nach Fukushima.

Neben dem wissenschaftlichen Austausch hatte das Forscherteam aus Fukushima und Nagasaki auch kulturelle Programmpunkte vorgesehen, wie zum Beispiel ein traditionelles Abendessen. Bild: © Shigehira Saji
Wie Babys lernen, sich gegen Bakterien und Viren zu verteidigen.
Zu Beginn unseres Lebens ist unser Immunsystem besonders formbar. Und das ist wichtig, um ein Gleichgewicht zwischen Toleranz und Abwehr zu etablieren und so die Reifung und Gesundheit zu fördern. Faktoren wie Gene, Zeitpunkt der Geburt, Geburtsmodus, Darmflora des Kindes, Ernährung, Infektionen und Impfungen, aber auch soziale Kontakte und Lebensbedingungen im Kindesalter spielen eine große Rolle bei der Entstehung von Gesundheit und Krankheit. Welche inneren und äußeren Faktoren im ersten Lebensjahr die Reifung des kindlichen Immunsystems gegen Viruserkrankungen der Atemwege beeinträchtigen oder fördern, das erforscht Prof. Dr. Dorothee Viemann, Leiterin der Translationalen Pädiatrie, gemeinsam mit der Kinderklinik und Frauenklinik in der neuen, von der DFG geförderten Geburtskohortenstudie MIAI (englisch für Maturation of Immunity Against Influenza).
Wie Babys lernen, sich gegen Bakterien und Viren zu verteidigen.
Zu Beginn unseres Lebens ist unser Immunsystem besonders formbar. Und das ist wichtig, um ein Gleichgewicht zwischen Toleranz und Abwehr zu etablieren und so die Reifung und Gesundheit zu fördern. Faktoren wie Gene, Zeitpunkt der Geburt, Geburtsmodus, Darmflora des Kindes, Ernährung, Infektionen und Impfungen, aber auch soziale Kontakte und Lebensbedingungen im Kindesalter spielen eine große Rolle bei der Entstehung von Gesundheit und Krankheit. Welche inneren und äußeren Faktoren im ersten Lebensjahr die Reifung des kindlichen Immunsystems gegen Viruserkrankungen der Atemwege beeinträchtigen oder fördern, das erforscht Prof. Dr. Dorothee Viemann, Leiterin der Translationalen Pädiatrie, gemeinsam mit der Kinderklinik und Frauenklinik in der neuen, von der DFG geförderten Geburtskohortenstudie MIAI (englisch für Maturation of Immunity Against Influenza).
Ganzkörperscan in wenigen Sekunden
Professor Dr. Thorsten Bley ist jeden Tag aufs Neue überrascht von den präzisen Bildern, die der neue von der DFG geförderte Photonenzählende Computertomograph aus dem Inneren des Körpers in Sekundenschnelle und bei halber Strahlendosis liefert. „Feinste Strukturen von Steigbügel, Hammer und Amboss im Ohr sind exakt dargestellt, ohne ein Bildrauschen. Wir können die kleinen Seitenäste der Herzkranzgefäße erkennen, Ablagerungen in der Gefäßwand darstellen und sogar eingebrachte Gefäßstützen, sogenannte Stents, untersuchen. Selbst Tumorzellnester im Knochenmark lassen sich im neuen CT erkennen“, so der Direktor des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie. Warum? „Weil der Detektor des neuen CT jedes einzelne Photon zählt, das durch den Körper geschickt wird, und nicht wie seine Vorgänger die Röntgenquanten in einem Lichtstrahl bündelt.“
Ganzkörperscan in wenigen Sekunden
Professor Dr. Thorsten Bley ist jeden Tag aufs Neue überrascht von den präzisen Bildern, die der neue von der DFG geförderte Photonenzählende Computertomograph aus dem Inneren des Körpers in Sekundenschnelle und bei halber Strahlendosis liefert. „Feinste Strukturen von Steigbügel, Hammer und Amboss im Ohr sind exakt dargestellt, ohne ein Bildrauschen. Wir können die kleinen Seitenäste der Herzkranzgefäße erkennen, Ablagerungen in der Gefäßwand darstellen und sogar eingebrachte Gefäßstützen, sogenannte Stents, untersuchen. Selbst Tumorzellnester im Knochenmark lassen sich im neuen CT erkennen“, so der Direktor des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie. Warum? „Weil der Detektor des neuen CT jedes einzelne Photon zählt, das durch den Körper geschickt wird, und nicht wie seine Vorgänger die Röntgenquanten in einem Lichtstrahl bündelt.“

Weltweit größte Studie zur Verbesserung der Dialyse
In der Studie RESOLVE wird in acht Ländern unter realen Bedingungen die vergleichende Wirksamkeit von zwei Standard-Dialysat-Natriumkonzentrationen bewertet. Für die Koordination in Deutschland konnte die angehende Nephrologin Dr. Jule Pinter vom UKW bei der DFG eine Förderung von 1,16 Millionen Euro einwerben.