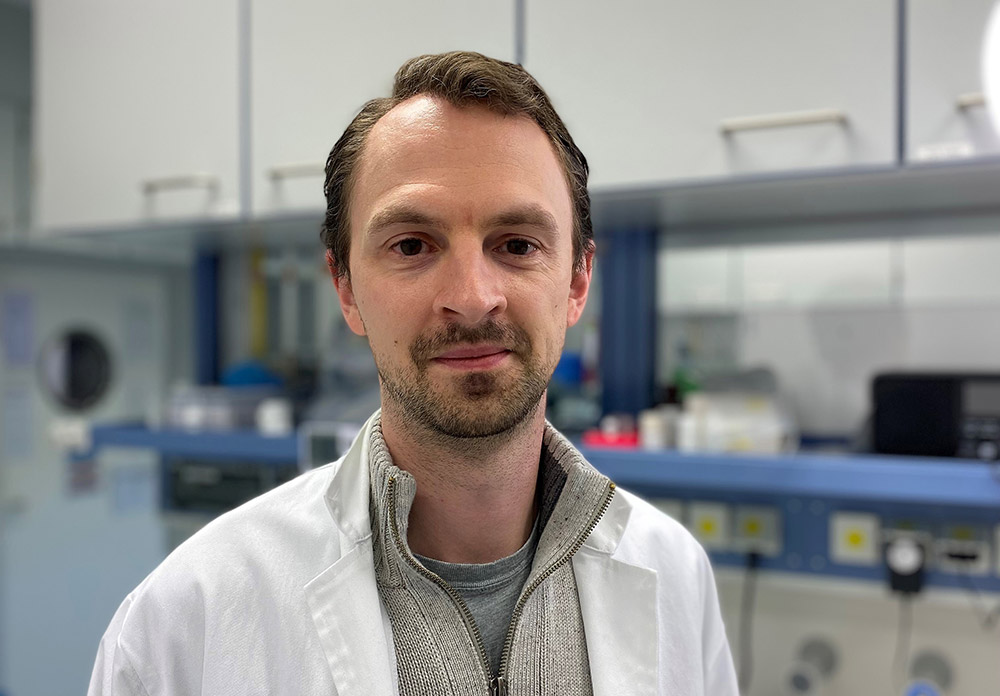Neue Professuren für Forschung und Lehre

Prof. Dr. Tomasz Jüngst (W1)
Der Mann, der Kunststoff zum Leben erweckt: Dr. Tomasz Jüngst ist zum Juniorprofessor für Biodruckverfahren ernannt worden. Der Physiker hat am Institut für Funktionsmaterialien und Biofabrikation bereits während und nach seiner Promotion zahlreiche 3D-Biodruckverfahren entwickelt. In der Prozessierung von 3D-Biodruckverfahren und in den Materialien zählt das Institut weltweit zu den führenden Einrichtungen. (siehe hier) Das Spezialgebiet von Tomasz Jüngst sind Blutgefäße – von großen Adern bis hin zu kleinsten Kapillaren. In selbst entwickelten und gebauten Melt- Electrowriting-Anlagen stellt er mit seinem Team aus wenigen „Krümeln“ Biopolymer, einer Art Kunststoff, das Gerüst für blutgefäßähnliche Strukturen her. So spinnt zum Beispiel eine Anlage in tagelanger Arbeit hauchdünne Fäden über eine Platte, die einer dünnen Mullkompresse ähnelt, nur eben mit viel feineren Strukturen. Im Zelllabor werden dann verschiedene Zellarten in und auf diese sterilisierten Gewebekonstrukte gegeben. In sieben Tagen bilden sich erste Strukturen aus, in 14 Tagen sind die Zellen in der Regel komplett ausgereift. Im EU-Projekt BRAVE (https://projectbrave.eu) entsteht so zum Beispiel ein biologisches „Pflaster“ fürs Herz, dessen Funktion nach einem Infarkt gestört ist. Werden die Polymere mit einem Hydrogel kombiniert, können verschiedene Zellarten sogar direkt mitgedruckt werden. Besonders stolz ist der Nachwuchswissenschaftler auf den Sonderforschungsbereich TRR225 „Von den Grundlagen der Biofabrikation zu funktionalen Gewebemodellen“, an dem er teilhaben darf und unter anderem Druck- und Testverfahren für biofabrizierte Gradienten entwickelt.

Prof. Dr. Florian Seyfried (W2)
Chirurgische Spezialisierung nach europäischem Vorbild: Alles um Magen und Speiseröhre aus einer Hand. Er ist ein akademischer Chirurg mit translationaler Ausrichtung. Sein Schwerpunkt sei unheimlich schön, weil inhaltlich hochspannend und innovativ, interdisziplinär, operationstaktisch extrem herausfordernd und sehr nah am Patienten. Florian Seyfried leitet die Chirurgie des oberen Gastrointestinaltrakts und die bariatrische Chirurgie am Universitätsklinikum Würzburg und hat Ende 2022 die neu eingerichtete, gleichnamige Professur erhalten. Das heißt: Er erforscht, lehrt, behandelt und operiert starkes Übergewicht sowie Funktionsstörungen der Speiseröhre und des Magens und bösartige Tumoren im oberen Verdauungstrakt.

Prof. Dr. Markus Bender (W2)
Blutplättchen auf der Spur: Das Blut, genauer gesagt die Blutplättchen, die vom Körper ein Leben lang gebildet werden, liegen Markus Bender schon lange am Herzen. Im Juni 2022 hat der Biomediziner von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) eine Heisenberg-Professur zum Programm „Mechanismen der Thrombozytopoese und Thrombozytenfunktion unter physiologischen und pathologischen Bedingungen“ erhalten. Mit seinen Forschungsarbeiten will der frisch ernannte Professor für Kardiovaskuläre Zellbiologie am Lehrstuhl für Zelluläre Immuntherapie einen entscheidenden Beitrag zum besseren Verständnis über der Produktion von Thrombozyten leisten, indem er die zugrunde liegenden molekularen Mechanismen und Schlüsselproteine dieses Prozesses im normalen, aber auch im krankhaften Zustand entschlüsselt. Mit seiner Forschung kann er zu neuen Therapiemöglichkeiten bei Patientinnen und Patienten mit Defekten in der Thrombozytenfunktion beitragen.
Warum sind Tumore in der Mundhöhle so unterschiedlich? ERC Starting Grant für Kai Kretzschmar
Das orale Plattenepithelkarzinom ist die häufigste bösartige Tumorerkrankung der Mundhöhle. Es unterscheidet sich von Patient zu Patient sehr deutlich, etwa was die Entstehung von Metastasen oder das Ansprechen auf die Therapie betrifft. Warum ist dieses Karzinom so vielfältig? Das will Dr. Kai Kretzschmar, Gruppenleiter am Würzburger Mildred-Scheel-Nachwuchszentrum für Krebsforschung, in seinem neuen Projekt OralNiche herausfinden. Der Europäische Forschungsrat (European Research Council, ERC) unterstützt seine Forschung mit einem Starting Grant in Höhe von 1,77 Millionen Euro. Kai Kretzschmar durfte sich im Jahr 2022 über eine weitere Auszeichnung freuen. Er wird zwei Jahre lang dem ersten Nachwuchsredaktionsausschuss des Fachjournals Stem Cell Reports der Internationalen Gesellschaft für Stammzellforschung (ISSCR) angehören. Von den Mitgliedern ist er das einzige aus einer europäischen Forschungseinrichtung.