STUDIENERGEBNISSE
Magenbypass bei Adipositas: leichter, fitter, zufriedener
In der Würzburger Adipositas Studie (WAS) vergleicht ein interdisziplinäres Team am Universitätsklinikum Würzburg die Effekte einer Magenbypass-Operation gegenüber einer intensiven und psychotherapiegestützten Lebensstil-Intervention.
Der Leidensdruck von Menschen mit starkem Übergewicht ist groß. Neben der Stigmatisierung und eingeschränkten Lebensqualität kommen Begleiterkrankungen wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen hinzu. Eine bariatrische Chirurgie kann Erleichterung schaffen und das Gesamtüberleben verbessern. In Würzburger Adipositas-Studie, kurz WAS, wurden die positiven Effekte einer Magenbypass-Operation auf die Lebensqualität und Herz-Lungen-Funktion gegenüber einer intensiven Lebensstil-Intervention nun erstmals randomisiert belegt.
60 Patientinnen und Patienten mit schwerem Übergewicht (durchschnittlicher BMI 48 (kg/m2) wurden über viereinhalb Jahre in der Studie betreut. Nach einer sechs- bis zwölfmonatigen Vorlaufphase erhielten 24 Studienteilnehmende eine psychotherapiegestützte Lebensstil-Intervention (PELI) und 22 einen Roux-en-Y-Magenbypass (RYGB). Bei der nach dem Schweizer Chirurgen César Roux benannten Operationsmethode wird der Magen verkleinert und die Nahrung durch eine künstlich angelegte, Y-förmige Verbindung an großen Teilen des Magens und des Dünndarms vorbeigeleitet. Als Folge des Eingriffs kann weniger Nahrung aufgenommen werden und der Darmhormonhaushalt ändert sich massiv.
„Bestimmte Nahrungsmittel wie Fleisch und Süßigkeiten werden dann oft nicht mehr gut vertragen“, erklärt die Studienärztin Dr. Ann-Cathrin Koschker. „Nach einem Jahr vertragen zwar viele wieder vieles, aber eben nicht alle alles, und man weiß vorher nicht, zu welcher Studiengruppe man gehört. Man muss wirklich bereit sein für diese Umstellung.“

Heike Reidinger (42) hat zunächst in der PELI-Gruppe 12 kg abgenommen. Sie nahm aber nach Studienende das Angebot war und ließ sich nachträglich operieren. Studienärztin Ann-Cathrin Koschker (rechts) hat sie die ganze Zeit über begleitet. Heute ist sie 40 kg leichter, topfit und glücklich. Jedes Modul sei wertvoll gewesen, sagt sie rückblickend, aber vor allem die psychotherapeutische Betreuung habe ihr gutgetan. Eine Anlaufstelle zu haben, um „aufzuräumen“, sei von immenser Bedeutung. Bild: Daniel Peter
Fast 3 Wasserkästen, die man weniger mit sich herumträgt
Während die Teilnehmenden der PELIGruppe im Schnitt 2 Kilogramm innerhalb eines Jahres abnahmen, verloren die Probandinnen und Probanden mit Magenbypass 34 Prozent ihres Körpergewichts. Im Schnitt waren die Teilnehmenden in der chirurgischen Gruppe 1,67 Meter groß, wogen zu Beginn 136 Kilogramm und brachten ein Jahr nach der Operation 47 Kilogramm weniger auf die Waage. Ihr BMI sank von 49 auf 31 kg/m2. „Das sind fast drei handelsübliche Wasserkästen mit zwölf gefüllten 0,7 l Glasflaschen, die man weniger mit sich herum trägt“, rechnet Martin Fassnacht, Leiter des Lehrstuhls Endokrinologie und Diabetologie, vor.
Bessere Sauerstoffaufnahme, Fitness und Lebensqualität
Der eklatante Gewichtsverlust in der RYGB-Gruppe hat sich sichtlich positiv auf die Lebensqualität, Herzfunktion und Begleiterkrankungen ausgewirkt. „Wir haben im Herzultraschall gesehen, dass die Masse des Herzmuskels im Verlauf eines Jahres um 32 Gramm zurückging. Das war ein unerwartet starker Effekt“, meint Prof. Dr. Stefan Störk, Leiter der Klinischen Forschung am DZH, der gemeinsam mit Martin Fassnacht die Adipositas-Studie geleitet hat. Das hat sich auf die Leistungsfähigkeit ausgewirkt. Bei der Spiroergometrie konnten die RYGB-Operierten ihre Sauerstoffaufnahme um 4,3 ml/min/kg steigern. Beim 6-Minuten-Gehtest schafften sie 44 Meter mehr als vor der Operation.
Die PELI-Gruppe fühlte sich nach der intensivierten Lebensstil-Intervention ebenfalls etwas fitter und berichtete eine leicht verbesserte Lebensqualität. Bei den Operierten jedoch fiel diese Verbesserung mit +40 Punkten auf der Physical Functioning Scale (Fragebogen zum Gesundheitszustand SF-36), wesentlich deutlicher aus als in der PELI-Gruppe mit +10 Punkten. „Damit war die Lebensqualität der Operierten praktisch wieder so gut wie die von gesunden Normalpersonen“, konstatiert Dr. Bodo Warrings, der die psychotherapeutische Intervention begleitet hat. Wichtig sei, das die Operation in einen Gesamt-Therapieplan mit Lebensstil-Interventionen integriert sei.
Effekte haben klinische Relevanz „Die Größe der beobachteten Effekte deutet übereinstimmend darauf hin, dass diese Veränderungen klinisch relevant sind“, betont Martin Fassnacht. Beeindruckend seien zum Beispiel die Auswirkungen auf den Blutdruck nach dem chirurgischen Eingriff und dem damit einhergehenden Gewichtsverlust: obwohl die RYGB-Gruppe nach der OP weniger Blutdruckmedikamente als die PELI-Gruppe einnahm, hatte sie niedrigere Blutdruckwerte.
Telemedizin unabhängig von Herzpumpfunktion wirksam
Eine große Hoffnung in der Behandlung der Volkskrankheit Herzinsuffizienz liegt in der Telemedizin – der regelmäßigen Fernüberwachung von Vitalparametern, die dem medizinischen Fachpersonal eine frühere Reaktion bei Hinweisen auf Verschlechterung ermöglicht. Allerdings übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen das Telemonitoring derzeit nur bei Patientinnen und Patienten mit einer deutlich reduzierten linksventrikulären Pumpfunktion“, erläutert Dr. Fabian Kerwagen, Clinician Scientist am Deutschen Zentrum für Herzinsuffizienz Würzburg (DZHI) und Erstautor einer wegweisenden Publikation im European Journal of Heart Failure. Darin zeigt der angehende Kardiologe in Zusammenarbeit mit Prof. Stefan Störk, Leiter der Klinischen Forschung am DZHI, und Prof. Friedrich Köhler, Leiter des Arbeitsbereichs Kardiovaskuläre Telemedizin am Deutschen Herzzentrum der Charité (DHZC), dass Telemonitoring bei allen Formen der Herzinsuffizienz die Zahl der ungeplanten Krankenhaustage und Todesfälle reduziert, sowohl bei höhergradig reduzierter als auch bei leicht reduzierter oder erhaltener Pumpfunktion. Die Ergebnisse haben eine hohe Relevanz, denn der Bedarf an wirksamen Therapien für die Herzinsuffizienz mit erhaltener oder nur leicht reduzierter Pumpfunktion sei besonders hoch, da es für sie bislang deutlich weniger evidenzbasierte Behandlungsmöglichkeiten als für die Herzinsuffizienz mit reduzierter Pumpfunktion.
Wenn die Blutplättchen außer Kontrolle geraten
Das akute Lungenversagen (ARDS für Acute Respiratory Distress Syndrom) ist ein lebensbedrohlicher Zustand, der verschiedene Ursachen haben kann. Allen gemeinsam sind entzündliche Prozesse. Trotz verbesserter Behandlungsmöglichkeiten ist das Sterberisiko hoch. Selbst mit vermeintlich wirksamen Antibiotika hält die Entzündung oft an und schadet der Schutzbarriere der Blutgefäße in der Lunge, was zu einer immunvermittelten Verletzung des Lungengewebes führt. Die Hauptverantwortlichen für diesen schädigenden Prozess sind Neutrophile Granulozyten. Diese Art der weißen Blutkörperchen hilft dem Körper eigentlich dabei, Infektionen zu bekämpfen und Verletzungen zu heilen. Beim ARDS kommt es jedoch zu einer überschießenden Immunreaktion, welche von Thrombozyten befeuert wird.
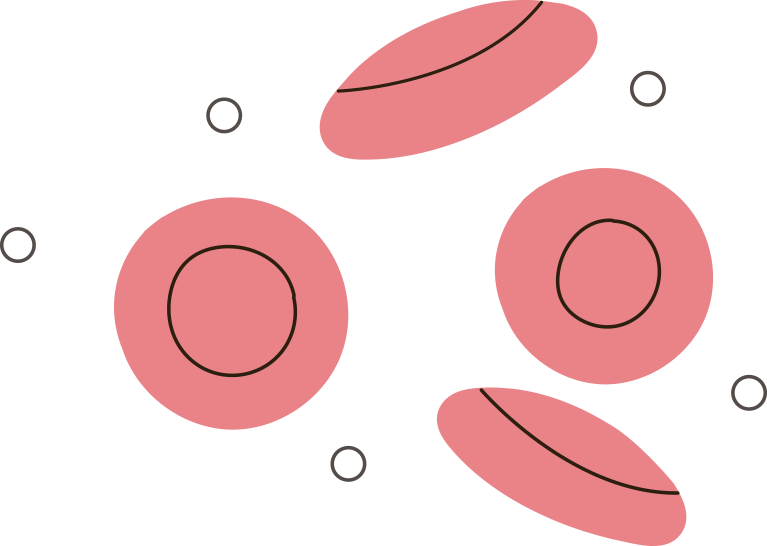
Bild: Dariia - stock.adobe.com
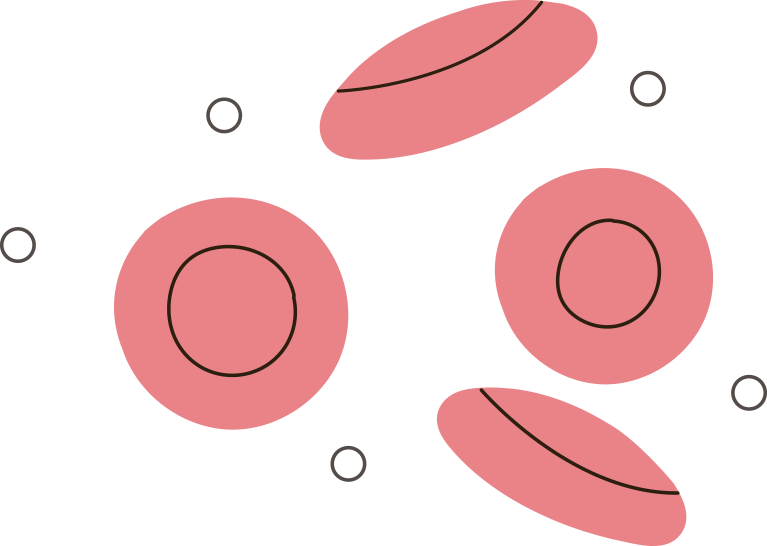
Bild: Dariia - stock.adobe.com
Wenn die Blutplättchen außer Kontrolle geraten
Das akute Lungenversagen (ARDS für Acute Respiratory Distress Syndrom) ist ein lebensbedrohlicher Zustand, der verschiedene Ursachen haben kann. Allen gemeinsam sind entzündliche Prozesse. Trotz verbesserter Behandlungsmöglichkeiten ist das Sterberisiko hoch. Selbst mit vermeintlich wirksamen Antibiotika hält die Entzündung oft an und schadet der Schutzbarriere der Blutgefäße in der Lunge, was zu einer immunvermittelten Verletzung des Lungengewebes führt. Die Hauptverantwortlichen für diesen schädigenden Prozess sind Neutrophile Granulozyten. Diese Art der weißen Blutkörperchen hilft dem Körper eigentlich dabei, Infektionen zu bekämpfen und Verletzungen zu heilen. Beim ARDS kommt es jedoch zu einer überschießenden Immunreaktion, welche von Thrombozyten befeuert wird.
Hemmung von GPVI verhindert Neutrophilen-Einstrom Einer, der die komplexen Funktionen von Blutplättchen schon seit Jahren erforscht und nun einen Ansatz gefunden hat, die Infiltration von Neutrophilen ins Lungengewebe zu unterbinden, ist Prof. Bernhard Nieswandt, Leiter des Lehrstuhls für Experimentelle Biomedizin I und Forschungsgruppenleiter am Rudolf-Virchow-Zentrum. In der im Fachjournal Blood publizierten Untersuchung hat seine Arbeitsgruppe einen vielversprechenden Angriffspunkt gefunden, um die akute Entzündung, die ALI/ARDS verursacht, zu reduzieren. Das aktivierende Thrombozytenrezeptor-Glykoprotein VI (GPVI) könnte eine entscheidende Rolle bei der Aktivierung und Ausbreitung der Thrombo-Inflammation spielen. „Wenn wir GPVI gezielt mit einem Antikörper unterdrücken, können wir das Ausmaß der überschießenden Immunreaktion unterbinden, wodurch sich die Barrierefunktion der Blut-Luft-Schranke und damit auch das klinische Ergebnis verbessert,“ erklärt Erstautor Philipp Burkard vom Institut für Experimentelle Biomedizin.