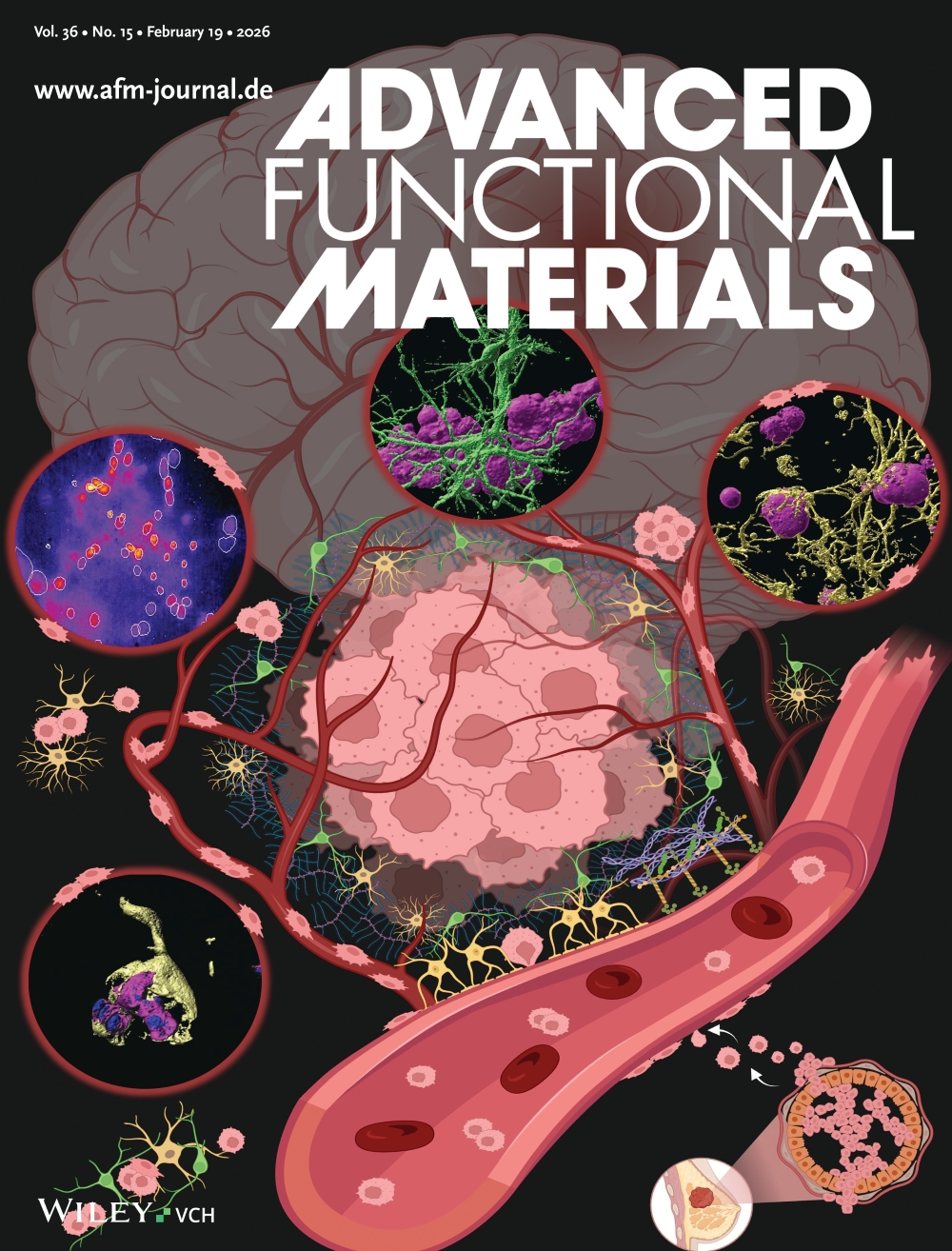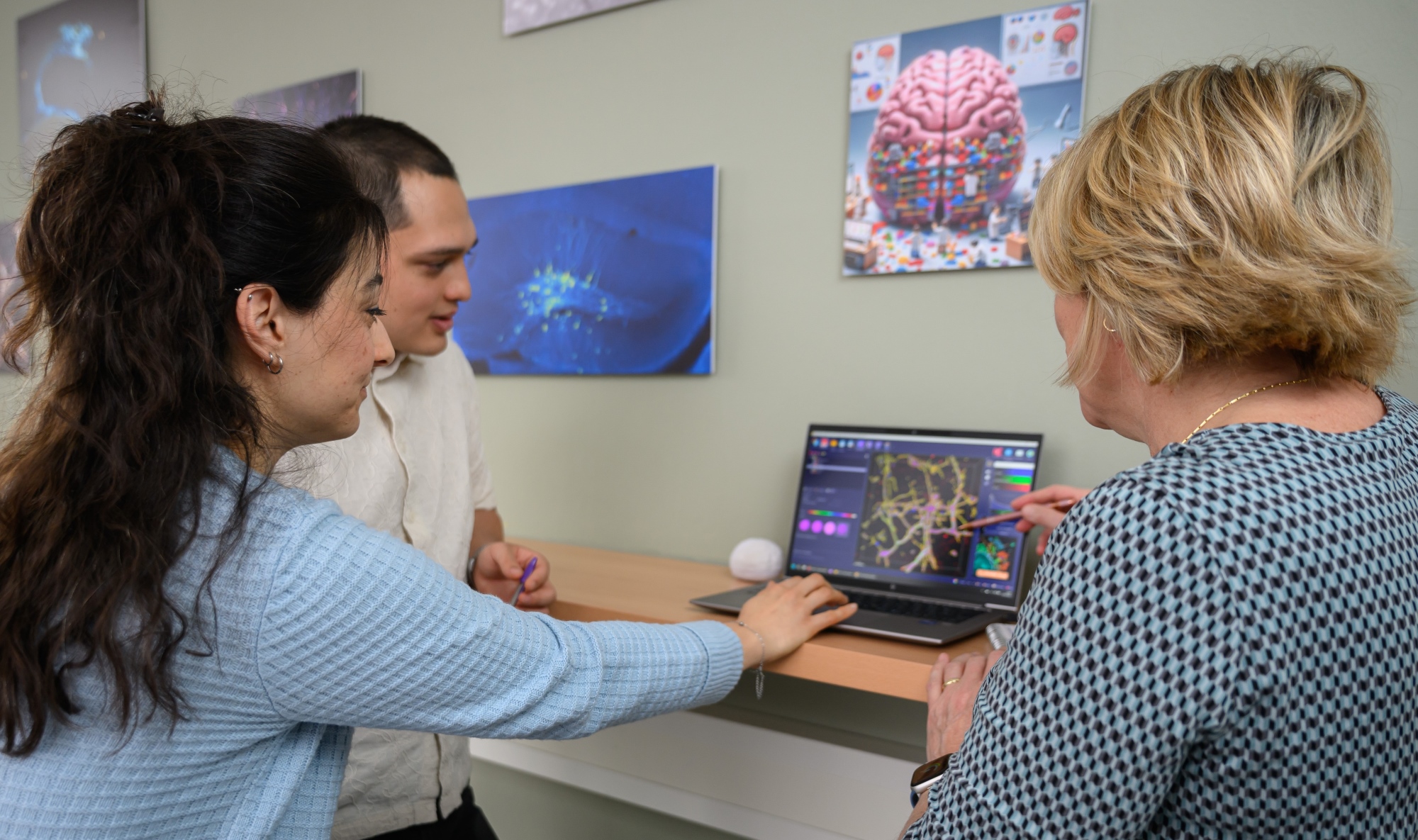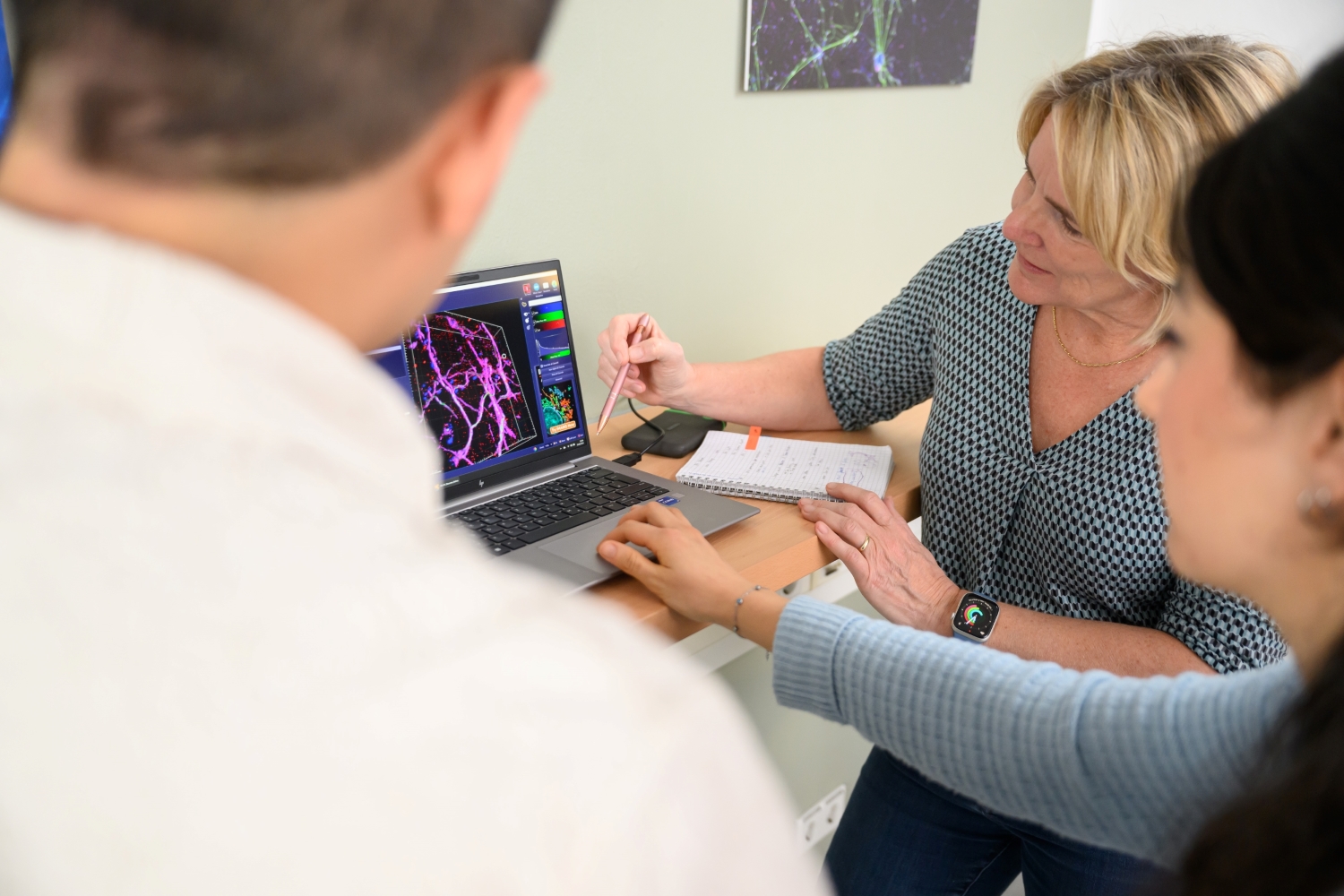Prof. Dr. Jonas Czwikla hat seit Januar 2026 die Professur für Versorgungsforschung am Institut für Klinische Epidemiologie und Biometrie der Universität Würzburg inne. Der Wissenschaftler, der zuvor an den Universitäten in Bremen und Oldenburg forschte und lehrte, versteht sich als epidemiologisch ausgerichteter Versorgungsforscher. Das heißt, er analysiert große Datensätze mit epidemiologischen Methoden und entwickelt Ideen für neue Versorgungsformen. Diese werden evaluiert, um bei einem positiven Effekt eine Implementierung in die Regelversorgung zu ermöglichen.
Würzburg. Der Blick auf das große Ganze fasziniert ihn - möglichst immer über den Tellerrand hinaus. Anstatt sich mit einzelnen medizinischen Fällen zu beschäftigen, widmet er sich ganzen Bevölkerungsgruppen. Sein Spektrum reicht von zu früh geborenen Kindern über Brustkrebsfrüherkennung für Frauen zwischen 50 und 75 Jahren bis hin zur medizinischen Versorgung von Pflegebedürftigen. „Mich hat schon immer mehr der gesundheitsorientierte Ansatz interessiert als der krankheitsorientierte. Wie verhindern wir, dass Menschen krank werden?“, sagt Prof. Dr. Jonas Czwikla. Deshalb entschied sich der gebürtige Wiesbadener nach dem Abitur am beruflichen Gymnasium für Gesundheit in Koblenz gegen ein Medizinstudium und für den Studiengang Public Health und Gesundheitswissenschaften an der Universität Bremen.
Krankheiten vorbeugen und bestmöglich versorgen
Während seines Studiums begeisterte sich Czwikla insbesondere für die Epidemiologie und Versorgungsforschung. Heute versteht sich der 36-Jährige als epidemiologisch ausgerichteter Versorgungsforscher. In der klassischen Epidemiologie beschäftigt er sich unter anderem mit folgenden Fragen: Wie ist die Krankheitslast in der Bevölkerung verteilt? Welche Krankheiten gibt es, wie oft treten sie auf und bei wem? Und wie können wir sie verhindern? Gleichzeitig analysiert er mit epidemiologischen Methoden, wie Menschen mit diesen Krankheiten von welchen Ärztinnen und Ärzten mit welchen Leistungen versorgt werden. Welche neuen Versorgungskonzepte gibt es? Und wie können wir den Fachkräftemangel bewältigen? Czwikla zufolge ist es besonders spannend, die klassische Perspektive der Epidemiologie um versorgungsbezogene Fragestellungen zu erweitern und gemeinsam mit einer Vielzahl von Partnerinnen und Partnern aus Forschung, Politik und Praxis zu einer Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung beizutragen.
Seit dem 1. Januar 2026 geht Jonas Czwikla seinen Fragen und Aufgaben als neuer Professor für Versorgungsforschung am Institut für Klinische Epidemiologie und Biometrie der Universität Würzburg nach.
„Target Trial Emulation“ bei der Auswertung von Routinedaten
Ein wichtiger Baustein seiner Arbeit ist die Auswertung von Routinedaten. „Routinedaten der gesetzlichen Krankenversicherung sind größtenteils erst seit 2004 digital verfügbar und für die Forschung nutzbar“, erklärt Czwikla. In seiner Doktorarbeit beschäftigte er sich mit den Möglichkeiten und Grenzen der Evaluation von Krebsfrüherkennungsuntersuchungen anhand von Routinedaten der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland. In Bremen nutzte er solche Routinedaten zur Evaluation der Brustkrebssterblichkeit im deutschen Mammographie-Screening-Programm mittels Target Trial Emulation. Hierbei handelt es sich um ein innovatives Konzept, mit dem sich Beobachtungsstudien designen lassen, die trotz ihrer Limitationen der Qualität von randomisierten kontrollierten Studien nahekommen.
Evaluation des Mammographie-Screenings in Deutschland
Im Rahmen einer vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) koordinierten und unter Leitung der Universität Münster zusammen mit dem Landeskrebsregister Nordrhein-Westfalen (LKR NRW), dem Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie – BIPS und der Universität Bremen durchgeführten Studie ging Czwikla der Frage nach, ob Frauen, die am Mammografie-Screening teilnehmen, ein geringeres Risiko haben, an Brustkrebs zu sterben. In die Evaluation flossen auch Daten des Bayerischen Krebsregisters ein. „Anhand der ausgewerteten Daten, die einem Zeitraum von über zehn Jahren abdeckten, konnten wir zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, an Brustkrebs zu sterben, bei den Frauen, die am Mammographie-Screening teilnahmen, um 20 bis 30 Prozent niedriger war als bei den Frauen, die diese Früherkennungsmaßnahme nicht in Anspruch nahmen.“ Die Ergebnisse wurden im vergangenen Jahr bei einer Veranstaltung mit Bundesumweltminister Carsten Schneider und Bundesgesundheitsministerin Nina Warken in Berlin vorgestellt und fließen in die Weiterentwicklung der Entscheidungshilfe zum Mammographie-Screening des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) ein. Der G-BA legt fest, welche medizinischen Leistungen von den gesetzlichen Krankenkassen unter welchen Bedingungen bezahlt werden. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) werden schließlich Entscheidungshilfen erstellt, die Versicherte dabei unterstützen, die Vor- und Nachteile von Früherkennungsuntersuchungen abzuwägen.
Informierte Entscheidung ermöglichen
„Es freut mich immer besonders, wenn unsere Ergebnisse auch in die Praxis einfließen“, sagt Jonas Czwikla. Er betont jedoch: „Wir wollen Frauen nicht zum Mammographie-Screening überreden, sondern sie transparent über den erwartbaren Nutzen und mögliche unerwünschte Effekte informieren. Auf dieser Basis sollen die Frauen eine informierte Entscheidung treffen.“ Das Konzept der Target Trial Emulation möchte er in Würzburg auch in anderen Themen- und Krankheitsbereichen anwenden.
Fokus auf medizinischer Versorgung von Pflegebedürftigen
Ein weiterer Forschungsschwerpunkt von Jonas Czwikla ist die medizinische Versorgung von vulnerablen Bevölkerungsgruppen. In seiner Habilitation befasste er sich mit der medizinischen Versorgung von Pflegebedürftigen. „Wir haben inzwischen rund sechs Millionen Pflegebedürftige, mit stark steigender Tendenz. Jedes Jahr kommt derzeit nahezu eine halbe Million hinzu. Gleichzeitig wird es immer schwieriger, pflegerisches Personal zu akquirieren. Das wird das Versorgungssystem zukünftig ganz klar an seine Grenzen bringen. Hier wollen wir gemeinsam mit der Praxis Lösungen für eine bestmögliche medizinische Versorgung entwickeln“, erklärt Jonas Czwikla.
Als Beispiel nennt er Blasendauerkatheter in Pflegeheimen, deren Wechsel vor allem bei Männern nicht einfach ist. Obwohl ein solcher Wechsel im Heim möglich wäre, werden die Betroffenen vielerorts ins Krankenhaus geschickt, was für alle Beteiligten eine große Belastung darstellt. Czwikla führt aus: „Wir wollen gemeinsam mit den Einrichtungen Best-Practice-Beispiele identifizieren und Standards etablieren, die eine flächendeckende Versorgung im Heim ermöglichen und durch die Qualität und Sicherheit gewährleistet sind. Das heißt: Wir begleiten den gesamten Prozess von der Idee bis zur Implementierung in die Regelversorgung.“ Czwikla will jedoch nicht nur die medizinische Versorgung in Heimen, sondern auch die häusliche Versorgung verbessern. Schließlich werden mehr als 80 Prozent der Pflegebedürftigen zu Hause betreut.
Koordinierung des BARMER-Pflegereports
In Bremen arbeitete er bereits am jährlichen BARMER-Pflegereport mit und von Würzburg aus wird er dessen Veröffentlichung zukünftig koordinieren. Dabei wertet er mit seinem Team, Daten, Trends und Versorgungsprobleme im Pflegebereich systematisch aus, zeigt Entwicklungen, Probleme und mögliche Handlungsfelder auf und trägt so zu Diskussionen über Pflegestrategien sowie Reformbedarf bei. Hierbei wird er maßgeblich von Dr. Alexander Fassmer unterstützt, mit dem Czwikla gemeinsam an der Universität Oldenburg im Department Versorgungsforschung tätig war und der mit ihm nach Würzburg gekommen ist.
Uniklinikum Würzburg bietet große Kooperationspotenzial
Auf dem Campus der Würzburger Universitätsmedizin sieht Czwikla große Kooperationspotenziale, vor allem mit dem von Prof. Dr. Melanie Messer geleiteten Institut für Pflegewissenschaft. Mit Messer beantragte er bereits ein neues Forschungsprojekt. Auch zur Pädiatrie hat er bereits Kontakte geknüpft. Einerseits will er in Würzburg ein bewilligtes Projekt zur Antikoagulation bei Kindern in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie – BIPS umsetzen, das vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gefördert wird. Andererseits plant er gemeinsam mit Prof. Dr. Juliane Spiegler, der Ärztlichen Leiterin des Sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ) am Uniklinikum Würzburg, den Ausbau der Versorgungsforschung bei Kindern und Frühgeborenen.
„Der Standort Würzburg ist weit über die Landesgrenzen hinaus für seine exzellente Forschung bekannt, auch in den Bereichen Epidemiologie und Versorgung. Daher freue ich mich sehr über den Ruf nach Würzburg und darüber, dass ich dazu beitragen kann, die Versorgungsforschung noch weiter auszubauen“, sagt Jonas Czwikla. Der Wechsel von Norddeutschland nach Unterfranken sei ihm leichtgefallen. „Ich bin in der Nähe von Lahn, Mosel und Rhein aufgewachsen, daher fühle ich mich in der Weinregion Würzburg gleich heimisch. Und da ich eher der Fraktion Fleisch angehöre, ist die Versorgung in Franken für mich kein Problem“, schmunzelt der Vater einer Tochter und Triathlet.
Über Prof. Dr. Jonas Czwikla
Prof. Dr. Jonas Czwikla wurde 1989 in Wiesbaden geboren. Er wuchs im Taunus und Rheinland auf und besuchte nach der Realschule ein berufliches Gymnasium für Gesundheit in Koblenz, wo er sein Abitur machte. Anschließend studierte er Public Health in Bremen. 2012 schloss er sein Bachelor-Studium ab, 2014 sein Master-Studium mit den Schwerpunkten Versorgungsforschung und Gesundheitssystem. 2020 erlangte er die Doktorwürde im Fach Public Health mit dem Prädikat „summa cum laude“. 2025 habilitierte er im Fach Epidemiologie und Public Health an der Universität Bremen. Czwikla war über zehn Jahre lang als wissenschaftlicher Mitarbeiter im SOCIUM Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik tätig und arbeitete zeitgleich viele Jahre am Department für Versorgungsforschung der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Seit dem 1. Januar 2026 ist er Universitätsprofessor für Versorgungsforschung am Institut für Klinische Epidemiologie und Biometrie der Julius-Maximilians-Universität. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Versorgungsforschung, Epidemiologie und Public Health, wobei er sich insbesondere mit der Analyse von Primärdaten und Routinedaten der Gesetzlichen Krankenversicherung sowie mit der Evaluation von Public-Health-Interventionen beschäftigt.
Text: Kirstin Linkamp / Wissenschaftskommunikation