

Prof. Dr. Heike Rittner
Leiterin des Lehrstuhls für Schmerzmedizin
Wie ich zur (Schmerz)Medizin kam
Schon als Kind habe ich gerne Neues entdeckt. In der Oberstufe habe ich lange überlegt, ob ich Biologie oder Medizin studieren soll. Es wurde Medizin – mit dem Schwerpunkt molekulare Schmerzforschung. Ich finde: Als Medizinerin oder Mediziner muss man auch den Anspruch haben, dazu beizutragen, dass die Behandlung besser wird. Das bedeutet zwangsläufig, neben der Behandlung auch Forschung zu betreiben.
Ursprünglich wollte ich Kinderärztin werden. Nach dem Studium in Wien und Würzburg habe ich mein PJ (Praktisches Jahr) an verschiedenen Universitäten wie Yale und Basel gemacht und mein AiP (Arzt im Praktikum) in der Pädiatrie in Gießen absolviert. Danach ging ich als Postdoc zurück in die USA und arbeitete zweieinhalb Jahre in der Rheumatologie der Mayo Clinic (Rochester, Minnesota). Zurück in Deutschland waren die Stellen in der Pädiatrie aufgrund der Ärzteschwemme hart umkämpft. Aber wie so oft im Leben: Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere, vielleicht sogar eine bessere. Damals wurde Professor Christoph Stein von der Johns Hopkins University in Baltimore nach Berlin an die Charité berufen. Er hatte sich mit Opioidrezeptoren auf peripheren Schmerzfasern beschäftigt. Dabei ging es auch um Rezeptoren auf Immunzellen. Mit meinem immunologisch-rheumatologischen Hintergrund hatten wir eine Schnittmenge. Und so haben wir gemeinsam in Berlin ein Labor und eine klinische Forschungsgruppe aufgebaut. Das war eine tolle Zeit. Ich habe mich habilitiert, den Facharzt für Anästhesie gemacht und eine Weiterbildung zur Schmerzmedizinerin absolviert. Die Schmerzmedizin hatte auch den Vorteil, dass ich keine Dienste mehr machen musste. Denn in unserer Berliner Zeit haben wir drei Kinder bekommen.
Mein Weg nach Würzburg
Im Jahr 2008 wechselten wir an die Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie, in Würzburg. Das hatte damals schon einen sehr guten Ruf in der Schmerzmedizin, denn hier gab es eine der ersten Schmerzambulanzen in Deutschland und eine universitäre Schmerztagesklinik. Diesen Schwerpunkt habe ich sukzessive zum Zentrum für interdisziplinäre Schmerzmedizin (ZiS) ausgebaut, das ich seit 2021 leite. So gab in Würzburg ausgezeichnete Bedingungen, um etwas aufzubauen und weiterzuentwickeln.
Berufliche Meilensteine
Der jüngste und ganz wichtige Meilenstein in meiner Karriere ist die Einrichtung des Lehrstuhls für Schmerzmedizin, der in Deutschland einzigartig ist. Als Lehrstuhlinhaberin und Leiterin des ZiS vertrete ich nun die gesamte Schmerzmedizin am UKW in Forschung, Lehre und Behandlung.
Ein großer Wendepunkt in meiner Karriere war 2014 ein EU-Projekt mit Professorin Claudia Sommer. Ich begann viel mehr interdisziplinäre translationale Forschung zu betreiben. Und ich bin Claudia Sommer zutiefst dankbar, dass sie mich in ihre internationalen Netzwerke eingebunden hat. Ein großer Erfolg war 2020 die Bewilligung der Forschungsgruppe KFO 5001 ResolvePAIN durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Unsere Forschungsgruppe besteht aus insgesamt neun Arbeitsgruppen. Übergeordnetes Ziel ist es, die molekularen Mechanismen der Schmerzauflösung besser zu verstehen, um personalisierte und passgenaue Therapien zu entwickeln. Mit der Forschungsgruppe kam dann auch meine Forschungsprofessur.
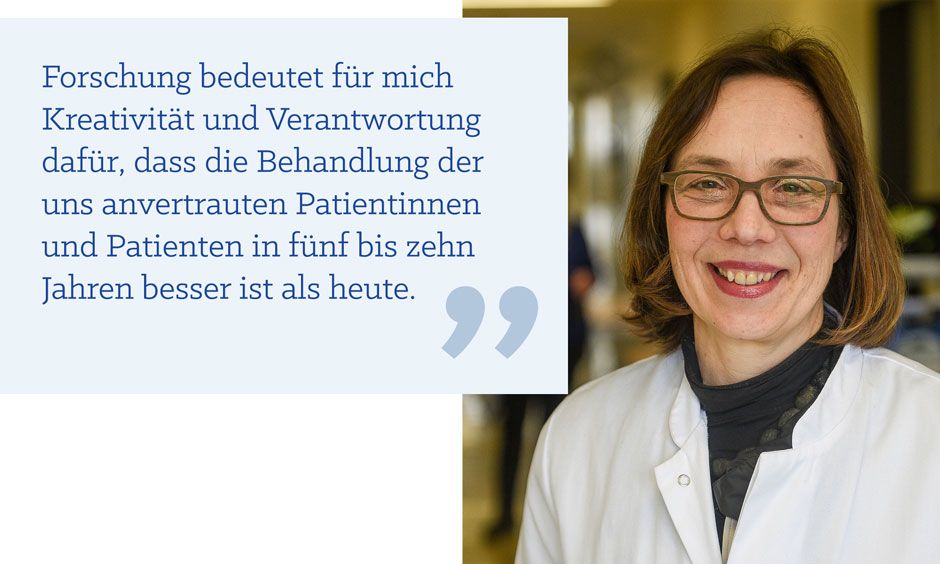
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Man braucht drei Dinge: den richtigen Partner, räumliche Nähe zum Arbeitsplatz und Hilfe annehmen. Ich stelle immer wieder fest, dass die (finanzielle?) Hemmschwelle bei den heutigen Müttern, einen Babysitter oder eine Kinderbetreuung zu engagieren, extrem hoch ist. Ich habe stets Vollzeit gearbeitet, als die Kinder klein waren, aber wir hatten immer sehr gute Kinderfrauen. Es ist etwas dran an dem Sprichwort „Es braucht ein Dorf, um Kinder zu erziehen“. Die Kinderfrauen habe auch immer wieder neue Aspekte in die Erziehung eingebracht. Und im Notfall war ich schnell zur Stelle. Das ist ein weiterer wichtiger Aspekt: in der Nähe der Klinik zu wohnen! Wenn man kurze Wege hat, spart man viel Zeit. Unterm Strich haben meine Kinder, auch nach eigenen Aussagen, nichts vermisst.
Was ich jungen Forschenden rate
Gehen Sie immer dorthin, wo es eine gute Infrastruktur gibt. Sonst wird man von der Bürokratie und den immer mehr werdenden Regularien erdrückt. Sie brauchen auch ein gesundes Selbstvertrauen und einen langen Atem. Die Wissenschaftsautorin Mai Thi Nguyen-Kim hat einmal gesagt: „Die meisten Hypothesen, die wir aufstellen, sind falsch.“ Das stimmt. Natürlich kann ich viele Hypothesen aufstellen, von denen ich weiß, dass sie richtig sind, aber die sind dann schrecklich langweilig. Forschung ist mit viel Frustration verbunden. Und damit müssen vor allem junge Forschende umgehen können. Um sich von Rückschlägen nicht unterkriegen zu lassen, brauchen sie gute Strukturen. Es muss klar sein, wofür sie sich einsetzen. Wenn fünf Versuche gescheitert sind, dann wird der sechste etwas.
Wie kann man Frauen (und Männer) für die Forschung begeistern?
Ich frage mich oft, wie wir den Nachwuchs motivieren können, sozusagen Blut zu lecken, um etwas Neues herauszufinden und zu überlegen, wie man das zum Patienten oder zur Patientin bringen kann. Wir müssen Neugier wecken. Natürlich braucht es auch Vorbilder. Wenn man als Frau eine Arbeitsgruppe leitet, hat man auch viele Frauen im Team. Dabei sind bei uns auch Männer herzlich willkommen. Ich bin ein Fan von gemischten Teams.
Hierarchische Strukturen
In der Ausbildung ist die Universitätsmedizin Würzburg mit dem Clinician Scientist Programm bereits sehr gut aufgestellt. Was ich hier aber vermisse, sind flache Strukturen, die mehr eigenverantwortliches Arbeiten ermöglichen. Wir brauchen mehr Juniorgruppen, in denen die Forschenden unabhängiger sein, sich selbst organisieren und entfalten können. Weniger Druck von oben und flache Hierarchien würden die Universitätsmedizin vor allem für Frauen attraktiver machen. Ein gutes Beispiel ist Yale. Die waren dort mit ihren Departmentstrukturen ganz anders organisiert. Ich habe dort mein PJ bei einer Kinderneurologin und einer Hämatologin gemacht, die ihre eigene Forschungsabteilung hatten – das war genial gut.
Die Medizin ist weiblich – unter einer gläsernen Decke
In der Medizin sind ein kluger Kopf, Verantwortung, zwischenmenschliche Kompetenz und ständiges Lernen gefragt, daran wird auch die Künstliche Intelligenz in Zukunft nichts ändern. In dieser Kombination fühlen sich Frauen sehr wohl, und sie sind gut darin. Deshalb studieren sehr viele Frauen Medizin. Aber je höher wir auf der Karriereleiter kommen, desto geringer wird der Frauenanteil.
Eine Umfrage des Marburger Bundes unter bayerischen Ärztinnen hat 2022 ergeben: „Die gläserne Decke in der Medizin ist immer noch Realität“. Die befragten Frauen nannten vor allem die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, konservative Rollenbilder, die in der Gesellschaft immer noch präsent sind und sich am Krankenbett wiederfinden und Vorurteile als Karriereblockaden.
Ja, die gläserne Decke ist immer noch da und es ist schwer, sie als Frau zu durchbrechen. Zwar gibt es inzwischen Vorgaben: 28 Prozent der W-Professuren sollen mit Frauen besetzt werden. Aber auf den höheren Ebenen ist der Frauenanteil immer noch sehr gering, die mächtigsten Positionen sind immer noch überwiegend von Männern besetzt. Andererseits muss die Qualität stimmen!
Meine Mentoren
Ich bin in einem akademischen Haushalt aufgewachsen, und mein Onkel war Ordinarius für Rechtsmedizin. Er hat mich immer sehr unterstützt und beraten. Das war hilfreich. Ich hatte auch sehr gute Lehrer und Mentoren, allen voran Professor Stein, der damals in Berlin ein sehr gutes Arbeitsumfeld geschaffen hat. Er war nicht nur in der Anästhesie brillant, sondern hat auch verstanden, was Forschung bedeutet: Hochrangige Publikationen kann man nicht nebenbei machen, man braucht eine Freistellung von der Klinik. Professor Roewer hat mich ebenfalls machen lassen, das fand ich sehr gut. Und als ich die beiden Rufe nach Zürich und Wien erhielt, boten mir das UKW und Professor Meybohm den Lehrstuhl an. Das Bleibeangebot des UKW war sehr wichtig für mich.
Meine Ziele
Wir wollen das ZiS noch mehr zum Strahlen bringen. Hier arbeiten verschiedene Fachdisziplinen und Berufsgruppen Hand in Hand. Neben der ambulanten Behandlung haben wir eine Schmerztagesklinik, in der wir verschiedene Therapiebausteine aufeinander abstimmen. Das läuft schon sehr gut. Aber ich würde mir wünschen, dass die Schmerzmedizin am UKW noch mehr in den Fokus rückt. Mir fehlt manchmal die Basis, dass alle die Kompetenzen in der Schmerzmedizin haben.
Und ich möchte den Forschungsschwerpunkt Schmerz weiter ausbauen. Wir wissen noch zu wenig darüber, wie Schmerz funktioniert und welche Mechanismen bei der Schmerzauflösung eine Rolle spielen. Wir müssen personalisierter arbeiten, weniger One-fits-all-Studien. Dazu benötigen wir eine Molekularisierung der Schmerzmedizin. Das heißt, wir untersuchen molekulare Marker in den Proben unserer Patientinnen und Patienten. Auf der anderen Seite kommt der biopsychosoziale Aspekt hinzu, was empfinde ich bei Schmerz. Schmerz ohne Gehirn geht nicht.
Krankheitslast Schmerz nimmt zu
Laut der Global Burden of Disease-Studie von The Lancet nimmt die weltweite Krankheitslast Schmerz in allen Altersgruppen zu. Allein in Deutschland sind mehr als 23 Millionen Menschen von langanhaltenden, chronischen Schmerzen betroffen, das heißt der Schmerz hat seine ursprüngliche Warnfunktion verloren. Eine Chronifizierung droht, wenn der Schmerz trotz leitliniengerechter Therapie nach drei bis vier Monaten nicht nachlässt. Spitzenreiter unter den Schmerzerkrankungen sind Rücken- und Kopfschmerzen. Der Anstieg ist einerseits darauf zurückzuführen, dass andere Erkrankungen inzwischen sehr gut behandelt werden können, andererseits gibt es mehr Auslöser. Die Gesellschaft wird älter, übergewichtiger und gestresster. Das hält uns von gesunden Prozessen ab. Schmerzmedizin ist oft die Dualität von Bewegung und Entspannung. Wie ich selbst Schmerzen vorbeuge? Mit einem ausgewogenen Lebensstil. Mein Mann und ich treiben gern Sport, wir haben jetzt Yoga für uns entdeckt. Einen weiteren Ausgleich finde ich in der Musik, ich spiele Geige.
Drei Wünsche
Privat bin ich sehr zufrieden – nur ein Timeturner von Hermine aus Harry Potter wäre super. Und der akademische Nachwuchs ist mir sehr wichtig: Ich möchte mehr Frauen und Männer für die Forschung begeistern, auch für die Schmerzforschung. Und die Strukturen an der Uni müssen zukunftsgewandter werden: flachere Hierarchien; Eigenverantwortlichkeit und Juniorgruppen könnten mehr Frauen und Männer begeistern.
