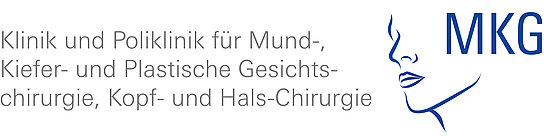Förderpreis der Stiftung „Forschung hilft“

Forschung
Forschungsschwerpunkte
Die Forschungsschwerpunkte der Mund-, Kiefer- und Plastischen Gesichtschirurgie umfassen die Themen Tumorbiologie beim oralen Plattenepithelkarzinom, Diagnostik und Evaluierung der Therapie bei Kindern mit kraniofazialen Fehlbildungen sowie intraoraler Hart- und Weichgeweberegeneration.
Außerdem beschäftigt sich die Forschung mit Immunevasionsmechanismen bei Kopf-Hals-Tumoren und mit der mundgesundheitsbezogenen Lebensqualität unserer Tumorpatientinnen und -patienten.
Forschungsgruppe Tumorbiologie beim oralen Plattenepithelkarzinom
Der Schwerpunkt der Forschung liegt auf der Identifikation der Mechanismen der Tumorentstehung und -progression. Hierbei richtet sich besonderes Augenmerk auf Signaltransduktionswege und ihre intrazellulären Schaltstellen. Darüber hinaus sollen die Möglichkeiten der Bekämpfung des oralen Plattenepithelkarzinoms und seiner Vorläuferläsionen untersucht werden. Hierbei spielen auch weitere Angriffspunkte wie Tumorantigene eine herausgehobene Rolle. Auf genetischer Ebene werden in Kooperation mit dem CCC Mainfranken Untersuchungen durchgeführt, Mutationen in Proteinen des Tumorzellstoffwechsels zu entdecken und für eine Therapie nutzbar zu machen. Diese Untersuchungen bilden die Grundlage zur Teilnahme an klinischen Medikamentenstudien, die unseren Patienten in Zusammenarbeit mit Studienambulanz für Solide Tumoren, zu Verfügung gestellt werden.
Ansprechpersonen:
Prof. Dr. Dr. Urs Müller-Richter
PD Dr. Dr. Stefan Hartmann
Dr. Axel Seher
Prof. Dr. Dr. Alexander C. Kübler
Diagnostik und Evaluierung der Therapie bei Kindern mit kraniofazialen Fehlbildungen
Im Rahmen verschiedener Studien werden Kinder mit allen Arten von Schädeldeformitäten (vom lagerungsbedingten Plagiozephalus, über Einzelnahtsynostosen bis hin zu komplex syndromalen Fällen) untersucht.
Neben Untersuchungen zur Wahrnehmung betroffener Kinder, ihrer neurokognitiven Entwicklung und den Ängsten und Sorgen der Eltern wird in aktuellen Arbeiten an der Verbesserung der Diagnostik und operativen Therapie, sowie der Verbesserung bestehender und Entwicklung neuer Behandlungsalgorithmen von Kindern mit kraniofazialen Anomalien gearbeitet.
Ansprechpersonen:
Dr. Dr. Hartmut Böhm
PD Dr. Felix Kunz (Kieferorthopädie)
Prof. Dr. med. Tilmann Schweitzer (Neurochirurgie)
Forschungsgruppe intraorale Hart- und Weichgeweberegeneration
Defekte von Mundschleimhaut und Knochen innerhalb der Mundhöhle stellen seit jeher ein großes Problem in der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie dar. In Kooperation mit dem Lehrstuhl für Funktionswerkstoffe der Medizin und der Zahnheilkunde werden in der Forschungsgruppe neue Biomaterialien zur Therapie solcher Defekte entwickelt und zum klinischen Einsatz gebracht.
Dies umfasst zum einen die Herstellung melt-elektrogesponnener, bakteriendichter Membranen aus medizinisch zugelassenem Polycaprolacton mit optimierten Wachstumsbedingungen für Mundschleimhaut- und Knochengewebe. Zum anderen werden neuen Anwendungsformen resorbierbarer Knochenersatzwerkstoffe, die eine schnellere knöcherne Regeneration gegenüber bisher verfügbaren Materialien aufweisen, entwickelt und untersucht. Hierbei werden unterschiedliche Kalzium-Magnesium-Phosphat-Pasten und Granulate in Tierversuchsmodellen anhand von orthotopen Defektmodellen getestet.
Im Fokus des Interesses stehen besonders das Degradationsverhalten der Pasten und Granulate, also deren Zersetzungsverhalten, sowie deren Umbau in ortsständigen Knochen. Darüber hinaus wird gegenwärtig ein mineralisches Knochenadhäsiv, also eine Art Kleber, entwickelt und im Tierversuchsmodell evaluiert, welches in ausgewählten Situationen eine Alternative zum traumatologischen Goldstandard der Plattenosteosynthese darstellen könnte.
Ansprechpersonen:
PD Dr. Dr. Andreas Fuchs
Prof. Dr. Dr. Alexander C. Kübler
Prof. Dr. Uwe Gbureck (Funktionswerkstoffe in Medizin und Zahnmedizin)
Projektrelevante Publikationen
Ewald A, Kreczy D, Brückner T, Gbureck U, Bengel M, Hoess A, Nies A, Bator J, Klammert U, Fuchs A (2019)
Development and Bone Regeneration Capacity of Premixed Magnesium Phosphate Cement Pastes.
Materials (Basel) 2019 Jul; 12(13): 2119. Published online 2019 Jul 1. doi: 10.3390/ma12132119
Fuchs A, Youssef A, Seher A, Hochleitner G, Dalton PD, Hartmann S, Brands RC, Müller-Richter UDA, Linz C (2019)
Medical-grade polycaprolactone scaffolds made by melt electrospinning writing for oral bone regeneration – a pilot study in vitro.
BMC Oral Health. 2019; 19: 28. Published online 2019 Feb 1. doi: 10.1186/s12903-019-0717-5
Brückner T, Fuchs A, Wistlich L, Hoess A, Nies B, Gbureck U (2019)
Prefabricated and Self-Setting Cement Laminates.
Materials (Basel) 2019 Mar; 12(5): 834. Published online 2019 Mar 12. doi: 10.3390/ma12050834
Fuchs A, Kreczy D, Brückner T, Gbureck U, Stahlhut P, Bengel M, Hoess A, Nies B, Bator J, Klammert U, Linz C, Ewald A (2021)
Bone regeneration capacity of newly developed spherical magnesium phosphate cement granules.
Clin Oral Investig. 2021 Oct 23. doi: 10.1007/s00784-021-04231-w. Online ahead of print.
Fuchs A, Youssef A, Seher A, Hartmann S, Brands RC, Müller-Richter UDA, Kübler AC, Linz C (2019)
A new multilayered membrane for tissue engineering of oral hard- and soft tissue by means of melt electrospinning writing and film casting - An in vitro study.
J Craniomaxillofac Surg. 2019 Apr;47(4):695-703. doi: 10.1016/j.jcms.2019.01.043. Epub 2019 Feb 4.
Renner T, Otto P, Kübler AC, Hölscher-Doht S, Gbureck U. (2023)
Novel adhesive mineral-organic bone cements based on phosphoserine and magnesium phosphates or oxides.
J Mater Sci Mater Med. 2023 Mar 24;34(4):14. doi: 10.1007/s10856-023-06714-6.
Platelet-rich fibrin (PRF) zur Unterstützung der Hart- und Weichgewebsheilung
Eine stadiengerechte Wundheilung ist im Fokus jeder Chirurgin und jedes Chirurgen. Leider gibt es Ausgangssituationen, in denen diese bekannterweise beeinträchtigt ist. Im klinischen Alltag begegnen uns beispielsweise bei Kiefernekrosen (Osteoradionekrosen oder Medikamenten-assoziierte Kiefernekrosen) häufig Wundheilungsstörungen, die zu einer Rezidivsituation führen. Um die Effekte von PRF auf die Wundheilung bei diesen Patientinnen und Patienten, aber auch bei gesunden Kontrollen zu ermitteln, untersuchen wir beispielsweise die biologischen Wirkungen auf Zellebene in verschiedenen experimentellen und klinischen Studien. Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern erlaubt es uns, die in vitro erlangten Erkenntnisse direkt auf den klinischen Alltag zu übertragen.
Ansprechpersonen:
Dr. Dr. A. Straub
PD Dr. Dr. Stefan Hartmann
In Kooperation mit der IZKF Group Tissue Regeneration in Musculoskeletal Diseases
Projektrelevante Vorarbeiten
Straub A, Brands RC, Borgmann A, Hohm J, Linz C, Müller-Richter UDA, Kübler AC, Hartmann S (2022)
Free skin grafting to reconstruct donor sites after radial forearm flap harvesting: A prospective study with platelet-rich fibrin (PRF)
J. Clin. Med. 2022 Jun 17;11(12):3506
Straub A, Vollmer A, Lâm TT, Brands RC, Stapf M, Scherf-Clavel O, Bittrich M, Kübler AC, Hartmann S (2022)
Evaluation of advanced platelet-rich fibrin (PRF) as a bio-carrier for ampicillin/sulbactam
Clin Oral Invest 2022 Dec;26(12):7033-7044
Straub A, Fischer M, Vollmer A, Stapf M, Linz C, Scherf-Clavel O, Lâm TT, Brands RC, Kübler AC, Hartmann S (2022)
Bone concentration of ampicillin/sulbactam: A prospective trial in patients with osteonecrosis of the jaw
Int. J. Environ. Res. Public Health 2022 Nov 13;19(22):14917
Stapf M, Straub A, Fischer M, Linz C, Hartmann S, Scherf-Clavel O (2023)
A liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for the quantification of ampicillin/sulbactam and clindamycin in jawbone, plasma, and plateled-rich fibrin: Application to patients with osteonecrosis of the jaw
J Pharm Biomed Anal. 2023 Feb 5;224:115167
Straub A, Utz C, Stapf M, Vollmer A, Kasper S, Kübler AC, Brands RC, Hartmann S, Lâm TT (2023)
Investigation of three common centrifugation protocols for platelet-rich fibrin (PRF) as a bio-carrier for ampicillin/sulbactam: a prospective trial
Clinical Oral Investigations 2023 Aug 21.
Organoid-Immunzell-Ko-Kultur-Modelle der Immunevasionsmechanismen in Kopf-Hals-Krebs
Kopf-Hals-Tumoren entgehen oftmals einer Bekämpfung durch das Immunsystem. Diesen Vorgang nennt man Immunevasion. Ein Mechanismus ist dabei, dass Tumorzellen auf der Zelloberfläche bestimmte Eiweißstoffe präsentieren, sogenannte Checkpoint-Proteine. Werden diese von den Immunzellen erkannt, führt das dazu, dass die Immunzellen nicht aktiv werden. Eine Behandlung mit sogenannten Immuncheckpoint-Inhibitoren (ICIs, zum Beispiel Pembrolizumab oder Nivolumab) kann dies verhindern und führte in verschiedenen Studien zu einer signifikant höheren Gesamtüberlebensrate bei wiederkehrendem oder metastasierendem Kopf-Hals-Krebs. Allerdings sprechen nur circa 20 Prozent der Patientinnen und Patienten auf die Behandlung an. In diesem Projekt soll deshalb die Frage beantwortet werden, was für die ICI-Therapie empfängliche Tumorzellen von denen unterscheidet, die nicht von einer solchen Behandlung beeinflusst werden.
Eigene Vorarbeiten haben gezeigt, dass die Stimulation bestimmter Signal-Übertragungswege dazu führt, dass ein immunsuppressives Mikromilieu entsteht. Am Ort des Tumors ist also das körpereigene Immunsystem unterdrückt. Das veränderte Mikromilieu zeichnet sich beispielsweise durch einen veränderten Stoffwechsel sowie ein vermehrtes Vorhandensein des Oberflächenproteins PD-L1 auf den Tumorzellen aus. Die zugrundeliegenden Mechanismen und die resultierenden Effekte wollen wir weiter aufklären. Dazu werden aus Proben von Kopf-Hals-Tumor-Patientinnen und -Patienten 3D-Zellkulturen angelegt, sogenannte Tumor-Organoide, und aus dem Blut der Patientinnen und Patienten Tumor-spezifische Immunzellen gewonnen.
Mittels gemeinsamer Kultivierung von Tumor-Organoiden und Immunzellen soll untersucht werden welche Immunevasion-Mechanismen in Kopf-Hals-Tumorzellen vorliegen und welche Mechanismen die Wirkung von ICIs verhindern.
Ansprechpersonen:
PD Dr. Dr. Stefan Hartmann
Dr. Verena Boschert
Dr. Kai Kretzschmar (Mildred-Scheel-Nachwuchszentrum Würzburg)
Projektrelevante Vorarbeiten
Boschert V, Teusch J, Müller-Richter UDA, Brands RC, Hartmann S (2022)
PKM2 modulation in head and neck squamous cell carcinoma
Int. J. Mol. Sci. 2022, 23(2), 775
Boschert V, Teusch J, Aljasem A, Schmucker P, Klenk N, Straub A, Bittrich M, Seher A, Linz C, Müller-Richter UDA, Hartmann S (2020)
HGF-induced PD-L1 expression in head and neck cancer: preclinical and clinical findings
Int J Mol Sci. 2020 Nov 20;21(22):8770
Boschert V, Klenk A, Abt A, Janaki Raman S, Fischer M, Brands RC, Seher A, Linz C, Müller-Richter UDA, Bischler T, Hartmann S (2020)
The influence of Met receptor level on HGF-induced glycolytic reprogramming in head and neck squamous cell carcinoma
Int J Mol Sci. 2020 Jan 11;21(2):471
Mundgesundheitsbezogene Lebensqualität und Gebrechlichkeit ("frailty") bei Patientinnen und Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren
Unsere Forschung in diesem Bereich beschäftigt sich mit der Lebensqualität der Patientinnen und Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren. Während in der Vergangenheit vorwiegend progressionsfreies und Gesamtüberleben der Patientinnen und Patienten nach einer onkologischen Therapie im Vordergrund standen, verschiebt sich die Aufmerksamkeit in den letzten Jahren vermehrt auch in Richtung der Lebensqualität der Patientinnen und Patienten. Unsere Forschung erfasst in diesem Zusammenhang die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten in verschiedenen therapeutischen Situationen (zum Beispiel kurativ oder palliativ) und versucht so, die Versorgung der Patientinnen und Patienten zu optimieren.
Ebenso nimmt aufgrund des demographischen Wandels die Zahl älterer Tumorpatienten in den letzten Jahren stark zu. Wir untersuchen in diesem Projektbereich, wie hoch der Anteil gebrechlicher („frail“) Patientinnen und Patienten und worin deren Einschränkungen bestehen. Außerdem möchten wir erfassen, inwieweit die erfassten Parameter einen Einfluss auf die Therapieentscheidung und den Erfolg der Therapie haben.
Ansprechpersonen:
PD Dr. Dr. Stefan Hartmann
Dr. Anna Winter (Zahnärztliche Prothetik)
Projektrelevante Vorarbeiten
Winter A, Rasche E, Hartmann S, Krone M, Schmitter M, Kübler AC, Schulz SM (2021)
Validation of the German language version of the Liverpool Oral Rehabilitation Questionnaire version 3 in patients with squamous cell carcinoma of the head and neck
J Craniomaxillofac Surg 2021 Nov;49(11):1081-1087.
Winter A, Schulz SM, Schmitter M, Straub A, Kübler A, Brands RC, Borgmann A, Hartmann S (2022)
Oral health related quality of life in patients with medication-related osteonecrosis of the jaw: a prospective clinical study
Int J. Environ. Res. Public Health 2022 Sep 16;19(18):11709.
Winter A, Schulz SM, Schmitter M, Müller-Richter UDA, Kübler AC, Kasper S, Hartmann S (2022)
Comprehensive geriatric assessment and quality of life aspects in patients with recurrent/metastatic head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC)
Journal of Clinical Medicine
Kontakt, Öffnungszeiten, Sprechzeiten
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Montag bis Donnerstagnachmittag nur nach Terminvereinbarung
Spezialsprechstunden siehe Ambulante Behandlung
Anschrift
Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie, Kopf- und Hals-Chirurgie des Universitätsklinikums | Pleicherwall 2 | 97070 Würzburg | Deutschland