
Prof. Dr. Claudia Löffler
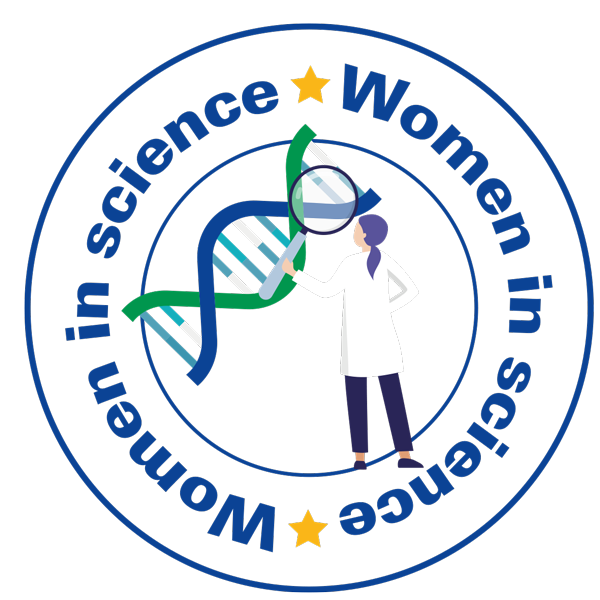
Komplementäre Onkologie Integrativ
Frau Löffler, Sie haben im Dezember 2016 die Komplementäre Onkologie Integrativ (KOI) am Comprehensive Cancer Center Mainfranken (CCC MF) am UKW eingeführt. Was ist das genau?
Unser Team möchte Patientinnen und Patienten während und nach einer Krebserkrankung dabei unterstützen, für sich selbst aktiv zu werden - im Sinne eines echten Empowerments. In zahlreichen Studien konnte nachgewiesen werden, dass Patientinnen und Patienten durch Bewegung, angemessene Ernährung und Stressreduktion ihre eigenen Ressourcen stärken können. Neben den Lebensstilbereichen Ernährung, Bewegung und Mind-Body-Verfahren gehört auch das ganzheitliche Management von Nebenwirkungen oder Spätfolgen der Therapie zu unseren Aufgaben. Dabei ist es uns ein besonderes Anliegen, nicht nur die Erkrankung, sondern auch den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen.
Was beinhaltet eine Beratung?
In unserer ärztlichen Sprechstunde geht es zunächst darum, herauszufinden, welche Symptome die Lebensqualität beeinflussen. Anschließend erarbeiten wir gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten einen Plan, wie sie ihre individuelle Situation mit Hilfe von Ernährungsinterventionen, Bewegung und Sport sowie Mind-Body-Verfahren bestmöglich unterstützen können. Je nach Bedarf können wir in unseren Sprechstunden zur Ernährung und Bewegung intensiver und gezielter auf die jeweiligen Situationen eingehen und individuelle Pläne gemeinsam erarbeiten. Darüber hinaus bieten wir eine naturheilkundliche Pflegesprechstunde an. In diesem Rahmen führen wir Anwendungen wie Wickeln, Auflagen, Aromapflege, Ohrakupunktur und Akupressur durch und zeigen bei Bedarf, wie man diese teilweise selbst zu Hause anwenden kann.
Sie haben im Oktober 2025 die neu eingerichtete Professur für Integrative onkologische Medizin an der Universität Würzburg angetreten. Was bedeutet das für Sie?
Die Einrichtung einer Professur für Integrative Onkologie ist ein wichtiges Signal dafür, dass es möglich und notwendig ist patientenzentrierte und ganzheitliche Medizin evidenzbasiert zu etablieren, die Wirksamkeit und Sicherheit der Verfahren in Studien weiter zu erforschen und das Potenzial auch der nächsten Generation in den Gesundheitsberufen so früh wie möglich zu vermitteln. Es ist mir ein persönliches Anliegen, die Integrative Onkologie als feste Säule in der modernen. multimodalen Krebstherapie zu verankern. Mein Team und ich sind dem Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst sowie unserer Universität sehr dankbar, dass wir diese Chance am Standort Würzburg bekommen und gemeinsam mit den Partnern in Bayern ein Kompetenznetz Integrative Medizin aufbauen dürfen.
Ihre Angebote basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Sie führen selbst zahlreiche sogenannte Supportiv-Studien durch. Können Sie Beispiele nennen?
Im August 2025 initiierten wir eine von der Carstens-Stiftung geförderte Studie zur Wirkung des Waldbadens (Shinrin-yoku) gegen Erschöpfung und Fatigue nach überstandener Krebserkrankung. Es gibt vielversprechende Hinweise aus anderen Settings, dass Shinrin-yoku Erschöpfung, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen und Depressivität positiv beeinflussen kann. In der FOREST-Studie werden Patienten nach dem Zufallsprinzip in drei Interventionsarmen vergleichend Waldbaden erleben: Eine Gruppe erhält das klassische Waldbaden - eine Achtsamkeitsintervention im Wald, die die Sinne Sehen, Hören, Riechen und Fühlen adressiert. Es gibt aber auch Menschen, die nicht naturnah wohnen oder zu erschöpft sind, um regelmäßig in den Wald zu gehen. Daher wird in einem zweiten Arm untersucht, ob es auch möglich ist den Wald zum Menschen zu bringen– mit VR-Brillen, Geräuschen und einer speziellen Mischung ätherischer Öle. Dem Aroma von Nadelbäumen (α-Pinen) werden nämlich unter anderem entzündungshemmende und angstreduzierende Effekte nachgesagt, so dass Wissenschaftler derzeit vermuten, dass es maßgeblich an der positiven Wirkung von shinrin-yoku beteiligt sein könnte. Vielleicht ist es aber genauso gut möglich das Bild des Waldes im Kopf entstehen zu lassen. Deswegen begibt sich die dritte Gruppe auf eine Fantasiereise durch den Wald. Die Teilnehmenden lassen unter Anleitung und unterstützt durch die α-Pinen angereicherte Aromamischung in ihrer Vorstellung das Bild des Waldes entstehen. Die vierte Gruppe ist die Kontrollgruppe.
Weitere Beispiele sind Studien zur Machbarkeit eines durch elektrische Muskelstimulation unterstützten Ganzkörpertrainings vor, während und nach einer allogenen Stammzelltransplantation sowie zur Wirksamkeit von Ohrakupressur nach dem NADA Protokoll bei Patienten mit fortgeschrittenen Tumorerkrankungen (zur Förderung der Lebensqualität, zur Linderung von Fatigue, Schlafstörungen und Schmerzen). Viele dieser Interventionen sind sehr nah am Leben, aber es ist gar nicht so einfach, sie zu untersuchen und auszuwerten.
Zum Thema Lebensstil - sich gesünder ernähren, mehr bewegen, Stress reduzieren. Vieles klingt sehr naheliegend und einfach. Wäre da nicht der innere Schweinehund.
Inzwischen wissen wir, dass kleine Dinge, konsequent umgesetzt einen großen Hebel haben können. Wenn wir diese Effekte durch Studien und begleitende Messungen sichtbar machen können, kann das eine starke Motivation für eine Verhaltensänderung sein. Oft überfordert man sich aber direkt und will zu viel auf einmal verändern. Wir raten daher eher dazu in möglichst kleinen Schritten vorzugehen. Man sollte sich beim Essen beispielsweise nicht plötzlich alles verbieten, sondern überlegen, wie man seine Gerichte aufwerten kann. Wer vorher wenig oder gar kein Gemüse gegessen hat, macht einen Anfang, indem er sich etwas Gemüse aufs Käsebrot legt. Also lieber bei den tiefhängenden Früchten anfangen. Nichts untergräbt die Motivation so sehr wie wiederholtes Scheitern.
Die Ziele sollten daher so formuliert werden, dass sie realistisch sind. Das lässt sich gut überprüfen, indem folgende Fragen gestellt werden: Wie wichtig ist Ihnen das Ziel – auf einer Skala von 0 bis 10? Und wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie das Ziel erreichen? Liegt einer der beiden Werte unter 7, lohnt sich das Anfangen oftmals noch nicht, denn das Risiko zu scheitern ist laut Studien dann extrem hoch. Besser ist es, das Ziel noch einmal kleiner zu machen oder anders zu formulieren und so lange anzupassen, bis man sagt: „Ja, das könnte klappen.” Selbst kleinste Erfolge stärken das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und das eigene Verhalten. Oft liegt es nicht an der Lust, etwas zu verändern, sondern am mangelnden Zutrauen. Wenn man dann aber sieht: „Ich schaffe das“, und spürt: „Das tut mir gut“, ist das der beste Ansporn, weiterzumachen und die Ziele dann auch Schritt für Schritt zu erweitern.
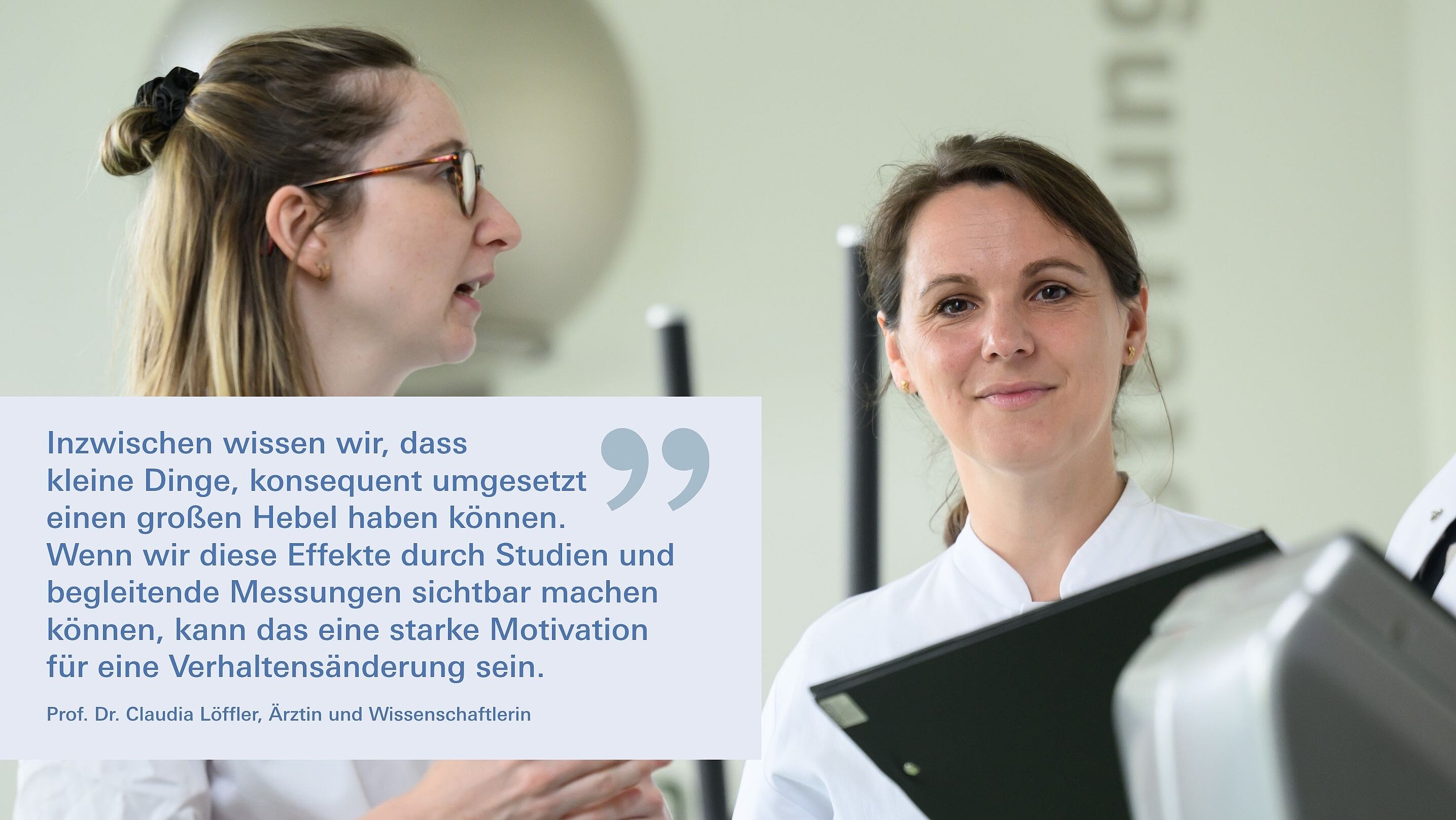
Die größte Gruppe, die Ihr Angebot annimmt, sind Brustkrebspatientinnen. 60 bis 70 Prozent der Patientinnen in Ihrer Sprechstunde sind von Brustkrebs betroffen. Warum ist gerade bei Brustkrebs der Bedarf so hoch?
Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen und führt gleichzeitig häufig zu Berufsunfähigkeit oder anhaltenden Einschränkungen im Berufsleben und Alltag. Ein Teil der Betroffenen hat mit zahlreichen Langzeitfolgen zu kämpfen, sodass sie nicht mehr im gleichen Umfang arbeiten können wie vor der Erkrankung. Dies wird jedoch oft erst nach abgeschlossener Behandlung klar. Nach erfolgreicher Therapie, Reha-Maßnahme und Wiedereingliederung stellen betroffene Frauen manchmal fest: Nichts geht mehr wie vorher. Sie wollen wieder in den Alltag, in ein normales Leben nach der Erkrankung, zurückkehren, schaffen es aber nicht allein.
Liegt es daran, dass sich das Belastungsmuster von Frauen nach wie vor von dem von Männern unterscheidet?
Ich denke es gibt viele Gründe dafür, warum Frauen nach einer Brustkrebsbehandlung oftmals sehr belastet sind. Ein Grund ist sicherlich, dass 80 Prozent der Brustkrebserkrankungen Hormonrezeptor-positiv sind. Die Blockade dieser Rezeptoren ist ein fantastischer Therapieansatz, der es ermöglicht hat das Ansprechen und insbesondere das Rezidivrisiko dramatisch zu reduzieren. Gleichzeitig hat der schlagartige Hormonentzug insbesondere bei jungen Frauen oft heftige Symptome zur Folge. Hinzu kommt aber sicherlich auch die Tatsache, dass die Situation von Frauen in der heutigen Zeit, in der sie ja meist auch berufstätig sind, eine Besondere ist. Nicht immer steht hinter einer erfolgreichen Frau ein Mann, der im Haushalt, bei der Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen mit anpackt. All diesen Herausforderungen gerecht zu werden, ist nicht ganz einfach. Für viele Frauen war das schon vor der Erkrankung zu viel, aber durch die Erkrankung- vielleicht auch durch die Erkenntnis, dass Kraft nicht unendlich vorhanden ist -kommen viele Frauen zu dem Schluss: So geht es nicht mehr. Diese Gewohnheitskultur zu durchbrechen und das gesamte Familienmodell sowie die Aufgabenverteilung zu überdenken, fällt vielen schwer.
Ihr Mann, Prof. Dr. Jürgen Löffler, forscht am Uniklinikum zu invasiven Pilzinfektionen und leitet das Labor der Medizinischen Klinik II. Wie ist bei Ihnen die Verteilung der Hausarbeit?
Ich habe einen Mann, der wahnsinnig toll supportet. Ohne ihn und seine liebevolle Unterstützung könnte ich meine beruflichen Visionen gar nicht leben. Wir haben eine super faire Verteilung der Aufgaben, wobei mein Mann fast mehr macht als ich! Das Beste daran ist, dass er sagt, er mache das auch gerne! Auch meine Mama übernimmt viele alltägliche To Dos und hält den Laden am Laufen.
Was wollten Sie als Kind werden?
Das wusste ich tatsächlich lange nicht. Ich hatte immer den Anspruch, etwas zu bewegen, wusste aber nicht, wie und wo. Ich wusste nur, was ich nicht werden wollte. Jurist wie mein Vater, den ich sehr geschätzt habe. Aber diese Streitereien vor Gericht fand ich schrecklich.
Wie kamen Sie dann zur Medizin?
Der Impuls, Medizin zu studieren, kam, als wir im Französischunterricht die Organisation „Ärzte ohne Grenzen” durchnahmen, die 1971 in Frankreich unter dem Namen „Médecins Sans Frontières” gegründet wurde. Tatsächlich war ich nach dem Medizinstudium auch im Ausland, nämlich an der kenianischen Küste. Der Aufenthalt war toll, hat meine Vorstellung aber auch entzaubert. Denn für die Behandlungen, die dort im Busch möglich waren, muss man gefühlt kein Medizinstudium absolviert haben. Zumindest nicht so wie ich mir das vorgestellt habe. Du verordnest Schmerzmittel, gegebenenfalls Antimalariamittel, bei Verdacht auf einen Infekt ein Antibiotikum, dann noch ein Mittel zum Entwurmen und Multivitaminsaft. Wer ein Kind dabei hatte, bekam außerdem Milchpulver. Die gespendeten Geräte, wie zum Beispiel ein EKG, konnten gar nicht eingesetzt werden. Das hat mich sehr gefrustet. Gleichzeitig hat es mir gezeigt, wie sehr wir beschenkt sind in einem Land mit einem so hervorragenden Gesundheitssystem zu leben. Aber der eigentliche Grund, warum ich mir Afrika nicht mehr vorstellen konnte, war mein Mann, den ich kurz zuvor am UKW kennengelernt habe.
Ihre Liebe begann am Uniklinikum Würzburg?
Ja, wir haben uns 2005 im Rahmen meiner infektiologischen Doktorarbeit kennengelernt. Das Labor in dem ich gearbeitet habe war direkt neben seinem und nur durch eine Glasscheibe getrennt. Eigentlich wollte ich in Ruhe arbeiten. Doch plötzlich hatten wir ein Date. Wir haben 2010 geheiratet und 2012 einen Sohn bekommen.
Wie erfolgte Ihre Spezialisierung auf die Hämato-Onkologie?
Zunächst waren es rein organisatorische Gründe. Professor Einsele, der Direktor der Medizinischen Klinik und Poliklinik II, hatte damals verschiedene Rufe von anderen Standorten erhalten. Wenn er gegangen wäre, wäre mein Mann wohl auch mitgegangen und somit ebenfalls ich. So war es naheliegend erstmal mit der Inneren Medizin zu starten. Ich bin dann sehr früh auf die Station für allogene Stammzelltransplantation gekommen und fand den Bereich zu meiner eigenen Überraschung richtig gut. Da die Patientinnen und Patienten recht lange auf der Station sind, baut man schnell eine intensivere Beziehung zu ihnen auf, als dies in anderen Fachgebieten meist der Fall ist.
Wie kam dann der Impuls zur komplementären Onkologie Integrativ?
Die Patientinnen und Patienten haben oft gefragt, was sie selbst zur Behandlung beitragen können. Ich konnte ihnen da nur wenige Ratschläge geben, was für mich einfach nur unbefriedigend war. Das Handwerkszeug, das ich im Studium vermittelt bekommen hatte, reichte aus meiner Sicht bei Weitem nicht aus, um meine Patientinnen und Patienten bestmöglich und insbesondere mit einem patienten- und ressourcenorientierten Ansatz zu betreuen. Oftmals hatte ich das Gefühl, manche Nebenwirkungen der Therapie nicht ausreichend gut kontrollieren zu können. „Aushalten“ schien mir keine gute Alternative zu sein. So kam es, dass ich mich zunächst nach einer TCM-Ausbildung und den Zusatzbezeichnungen Palliativmedizin und Naturheilkunde und Ernährungsmedizin beschäftigte. Später kamen noch zahlreiche weitere Interessen und Werkzeuge hinzu.
Gab es Stolpersteine auf Ihrem Karriereweg?
Es war nicht immer leicht, vor allem, als ich Mutter wurde und ein halbes Jahr später wieder in meinen Beruf zurückkehren wollte – und musste. Ich befand mich noch in der Facharzt-Ausbildung mit allen Diensten und Rotationen. Unter meinen Kolleginnen gab es nur wenige Frauen und noch weniger Mütter. Teilzeit war zu dieser Zeit nicht möglich. Zum Glück sprang mein Mann ein. Er konnte zum Beispiel tageweise im Homeoffice arbeiten, unseren Sohn zu Besprechungen mitnehmen, wann immer es möglich war, und engagierte sich auch intensiv bei der Krippeneingewöhnung, sodass ich meine Facharztausbildung absolvieren konnte. Und obwohl wir auch noch eine Oma zur Unterstützung vor Ort hatten, war diese Zeit extrem stressig. Erst Forschungs- und Rotationsprojekte brachten Freiräume. Dafür bin ich meinem Chef sehr dankbar, denn er hat mich dabei massiv unterstützt.
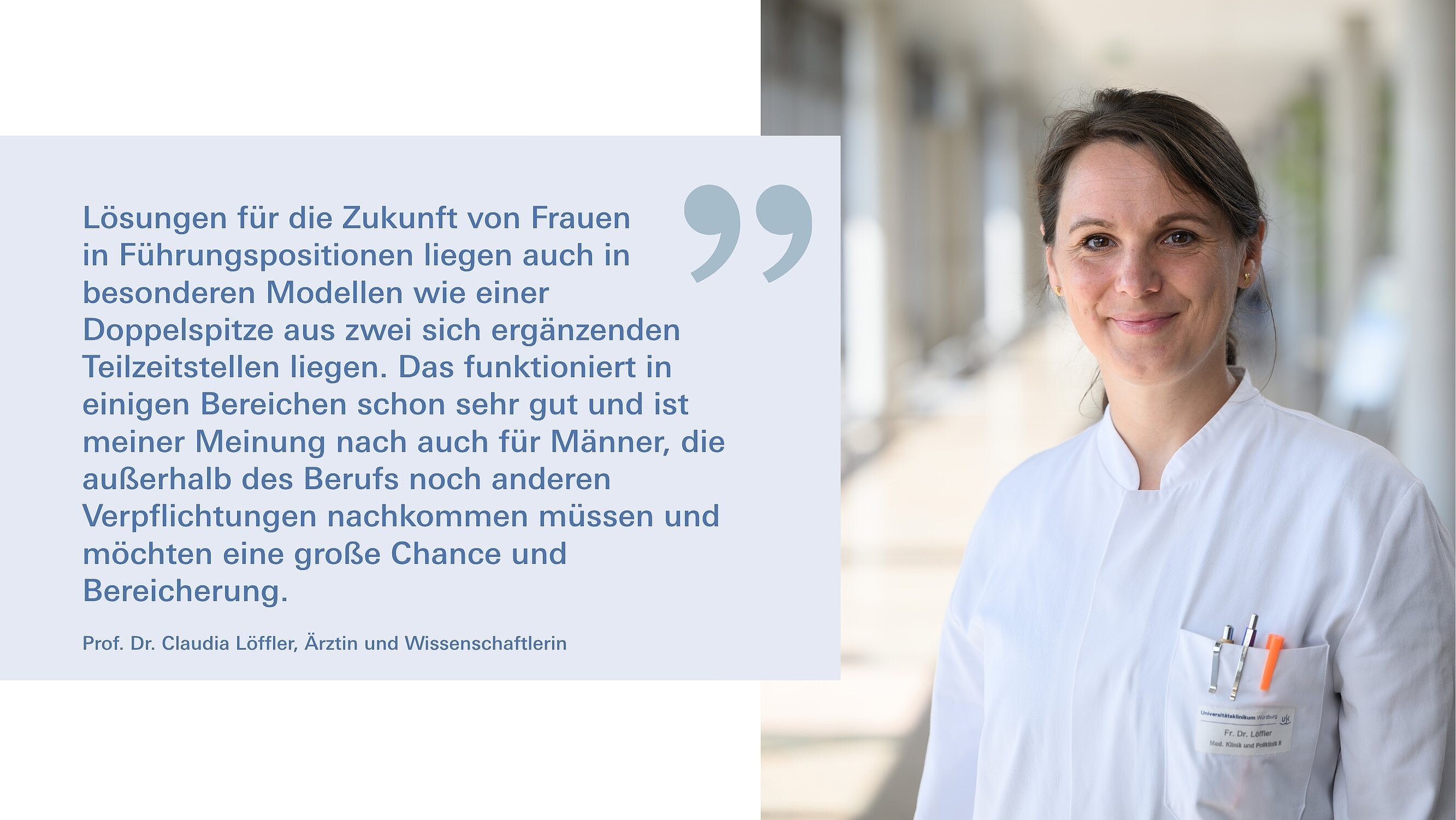
Zum Glück gibt es heute viel mehr Teilzeitstellen, oder?
Ja, das ist zweifellos eine Errungenschaft. Dennoch glaube ich, dass meine Kolleginnen in Teilzeit einen hohen Preis zahlen. Es ist für Teilzeitmütter trotzdem extrem schwer, mitzuhalten. Sie müssen es irgendwie schaffen die fehlenden Rotationen für den Facharzt bekommen. Ohne die zahlreichen Unterstützer in meinem Netzwerk wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Gerade wenn man auf der Karriereleiter nach oben möchte – beispielsweise bei Forschungsanträgen – werden oft hohe Anforderungen gestellt, die sich auf einer Teilzeitstelle nur schwer erfüllen lassen. Ich glaube, dass Lösungen für die Zukunft von Frauen in Führungspositionen auch in besonderen Modellen wie einer Doppelspitze aus zwei sich ergänzenden Teilzeitstellen liegen. Das funktioniert in einigen Bereichen schon sehr gut und ist meiner Meinung nach auch für Männer, die außerhalb des Berufs noch anderen Verpflichtungen nachkommen müssen und möchten eine große Chance und Bereicherung.
Was ist größte Herausforderung, damit Arbeitsplätze im Klinikum attraktiver werden?
Meiner Meinung nach stellt der stationäre Bereich die größte Herausforderung dar. In den Ambulanzen lässt sich aufgrund der klaren Arbeitszeiten erfahrungsgemäß besser planen. Auf der Station ist hingegen vieles nicht vorhersehbar. Nicht allen Patientinnen und Patienten geht es pünktlich zum Dienstschluss gut. Natürlich gibt es einen Dienstarzt, der die Patienten übernehmen kann, aber er kennt sie und ihre Krankengeschichte möglicherweise nicht so gut wie der Stationsarzt. Gerade in der Onkologie und in Fächern, in denen die Patientinnen und Patienten sehr krank sind und sich oft in emotionalen Ausnahmesituationen befinden, kommt es schnell zu ethischen Konflikten. Wer geht schon mit gutem Gefühl nach Hause, wenn es einem der eigenen Patienten gerade gar nicht gut geht? Auf der anderen Seite führt dies dazu, dass viele Kolleginnen und Kollegen oft viel zu lange arbeiten und die Arbeit gedanklich mit nach Hause nehmen. Ich glaube, dass ein Schichtsystem, ähnlich wie auf den Intensivstationen, gerade auf den Stationen mit unseren schwerstkranken onkologischen Patienten am besten funktionieren würde. So könnten die Patienten durchgehend durch ihre Stationsärzte versorgt werden, die sie am besten kennen, und die Ärzte müssten sich nicht zwischen Privatleben und Patientenversorgung entscheiden. Dafür bräuchte es allerdings mehr Arbeitskräfte. Ich halte das für einen wichtigen Schritt, um den Arbeitsplatz wieder attraktiver zu machen und die Fluktuation zu verringern. Zusätzlich bin ich überzeugt, dass es noch zu wenige Angebote gibt, um Fürsorgemüdigkeit und Burnout als Konsequenz von chronischer physischer und emotionaler Überlastung vorzubeugen. Wir müssen uns nicht nur um die Patienten, sondern auch um unsere Kolleginnen und Kollegen sowie um uns selbst kümmern. Ich bin der Meinung, dass man für andere am besten da sein kann, wenn man sich auch ausreichend gut um sich selbst kümmert. So wie es der Mönch Bernhard von Clairvaux im Gedicht „Schale der Liebe“ formuliert hat.
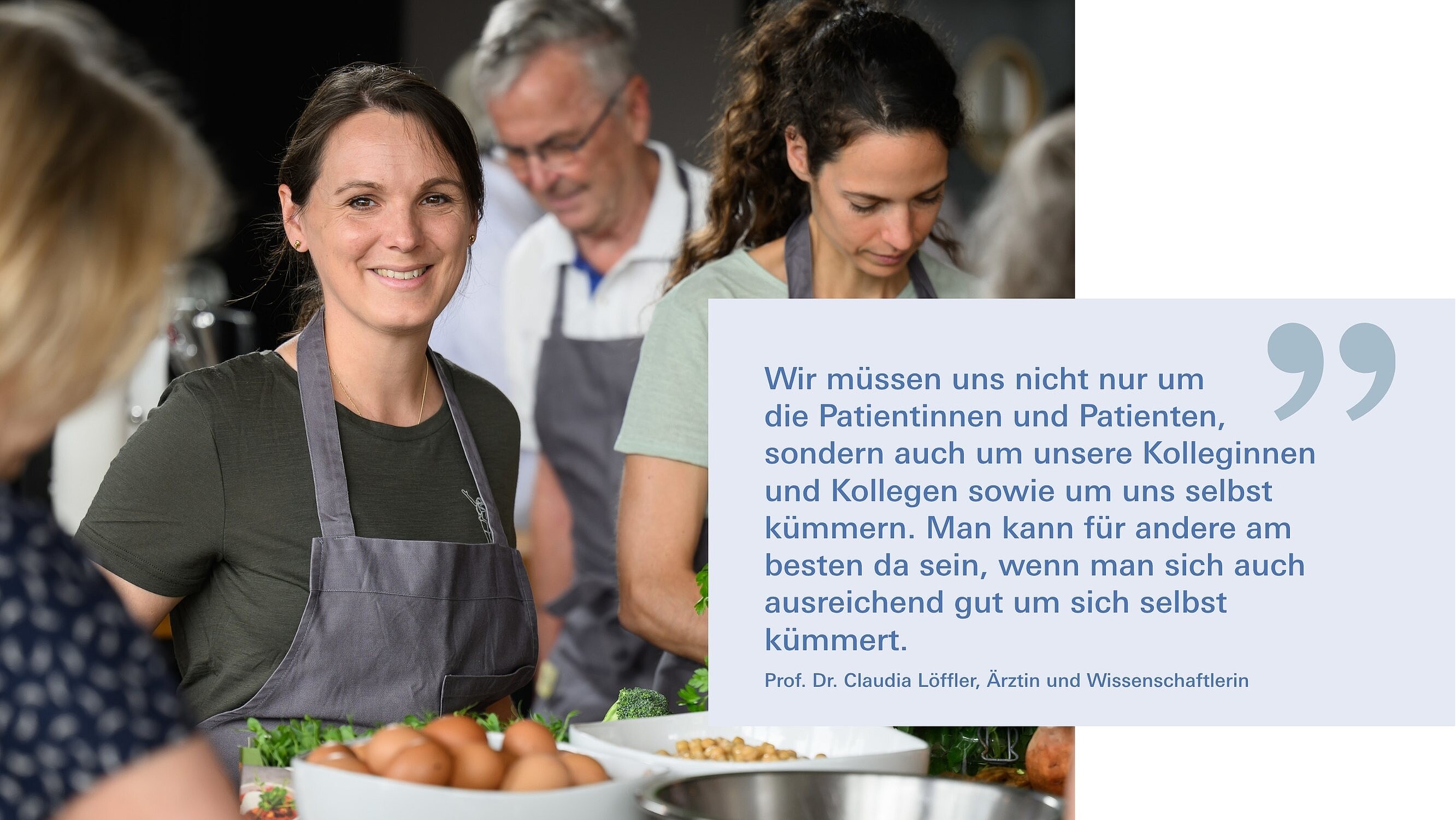
Wie sieht eine ideale Wertschätzung aus?
Für mich bildet die Basis unseres eigenen Teams, dass jedes Mitglied für den Erfolg und das Wohlergehen des gesamten Teams wichtig ist. Dafür ist es essenziell, den Teammitgliedern zu ermöglichen, sich weiterzuentwickeln, und sie am besten in den Bereichen einzusetzen, für die sie wirklich brennen. In meinen Mitarbeitergesprächen frage ich deshalb immer, ob es etwas gibt, das das Teammitglied besonders interessiert, und was es gerne ausprobieren und in dem es sich fortbilden möchte. Es ist sehr wichtig, dass alle im Team spüren, dass sie die Arbeit mitgestalten können und dass ihre Beiträge geschätzt werden. Einige sind so motiviert, dass sie sich sogar in der Freizeit weiterbilden. Wenn man merkt, dass man viel mehr kann, als man vielleicht angenommen hat, dann macht die Arbeit Freude oder man entdeckt den Spaß am Beruf neu. Ein weiterer wichtiger Punkt: Die Gesellschaft kann sich ändern, wenn das Bewusstsein für das gemeinsame Mensch-Sein zunimmt und Menschen sich auf Augenhöhe begegnen. Das ist gerade in unserem Beruf sehr wichtig.
Würden Sie sich heute noch einmal für die Medizin entscheiden?
Ich liebe meinen Beruf. Wenn ich Versorgungskonzepte und Studien entwickle und meine Ideen nur so sprudeln, bin ich aber oft auch traurig, dass ich nicht alle umsetzen kann, weil das Geld dafür fehlt oder auch die Zeit. Manches erarbeite ich gemeinsam mit dem Team auch ohne Förderung, weil ich einfach wissen will, was dahintersteckt und ob dieser oder jener Ansatz sinnvoll ist. Ein Kreativberuf hätte mir daher bestimmt auch gefallen. Oder eine Arbeit, die dort ansetzt, bevor Menschen krank werden, zum Beispiel im Bereich Achtsamkeit, Ernährung oder Sport. Prävention ist sehr wichtig, hat aber immer noch einen viel zu niedrigen Stellenwert in unserem Gesundheitssystem. Manchmal denke ich auch, dass ich auch mit einem Demeter-Bauernhof oder in einem anderen naturnahen Beruf glücklich wäre. Ich bin sehr naturverbunden, liebe es im Garten zu graben und Gemüse anzupflanzen. Ich lebe mit meiner Familie am Waldrand, mit Rehen im Garten –ein wunderschönes zu Hause.
Gab es abgesehen von Afrika weitere Aufenthalte im Ausland?
Nein, ich wollte zwar immer andere Gegenden kennenlernen und hatte eigentlich auch gar nicht vor, in Würzburg zu studieren. Aber ich fühlte mich damals der Jugendgruppe in meinem Heimatort Gemünden verpflichtet, die ich ehrenamtlich betreute. Nach dem Studium wollte ich dann endlich mal weg, aber da kam wie gesagt ein gewisser Schwabe in mein Leben. Letztendlich ist Würzburg ja auch eine sehr schöne und lebenswerte Universitätsstadt mit kurzen Wegen. Das ist ein großer Vorteil, wenn man ohnehin wenig Freizeit und noch Familie hat.
Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, welche wären das?
Ich wünsche mir, dass sich die Menschen – unabhängig von ihren persönlichen Herausforderungen – darauf besinnen, dass sie alle im gleichen Boot sitzen. Es macht mich manchmal extrem traurig, dass der Gedanke der „Common Humanity”, das Mitgefühl für die Situation anderer, oft auf der Strecke bleibt. Wir müssen nicht immer die Ersten und Besten sein. Es gibt andere Werte.
Zweitens wünsche ich mir, dass mein Team die Chance hat, weiter zu wachsen und die Projekte unter Bedingungen auszubauen, die es uns ermöglichen, dabei selbst gesund zu bleiben.
Und schließlich wünsche ich mir, dass es meiner Familie und den Menschen in meinem nahen Umfeld möglichst gut geht und sie frei von Leid mit einer gewissen Leichtigkeit leben können.
KOI-Sprechstunde
Die Sprechstunde für komplementäre Onkologie integrativ in der Ambulanz des CCC MF (supportivangebote@ukw.de; Telefon 0931 / 201 35350) wird von den Patientinnen und Patienten sehr gut angenommen und erfährt hohe Wertschätzung. Leider bleiben aus diesem Grund zum Teil längere Wartezeiten nicht aus. Für Notfälle, zum Beispiel wenn jemand aufgrund von starken Nebenwirkungen Probleme hat, die konventionelle Behandlung fortzusetzen, gibt es Extra-Slots. Erste Anregungen, um Körper, Seele und Wohlbefinden zu stärken, hat Claudia Löffler im vergangenen Jahr mit der Bayerischen Krebsgesellschaft zusammengestellt. Die Broschüre finden Sie hier.
