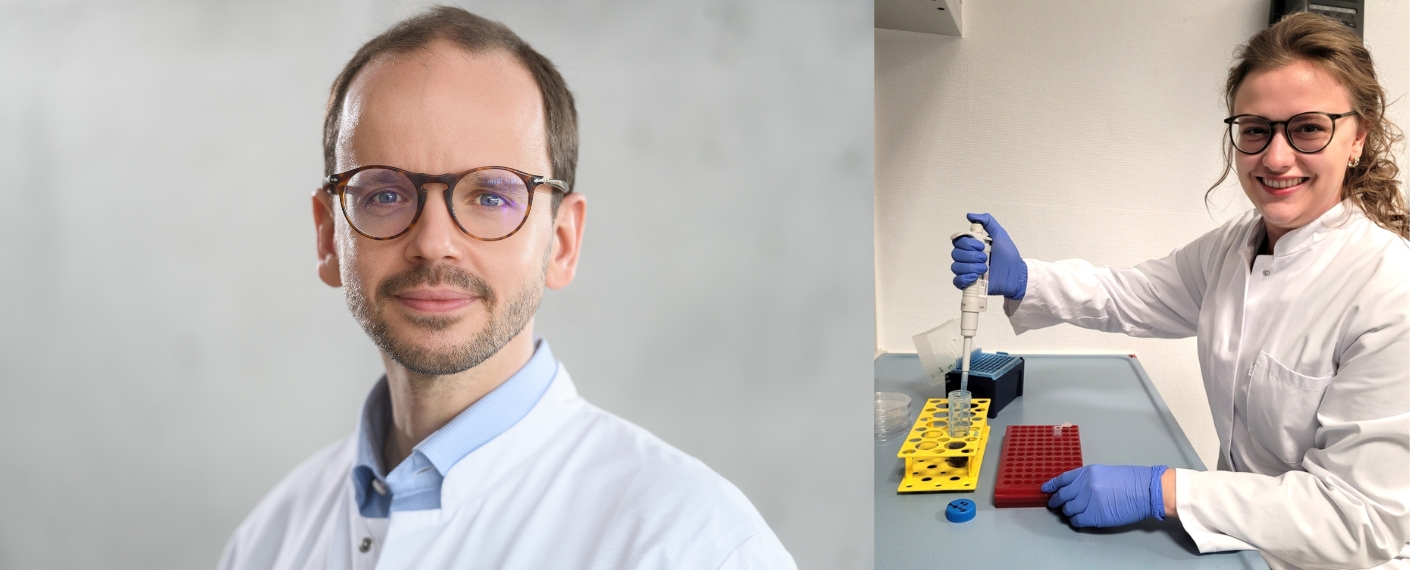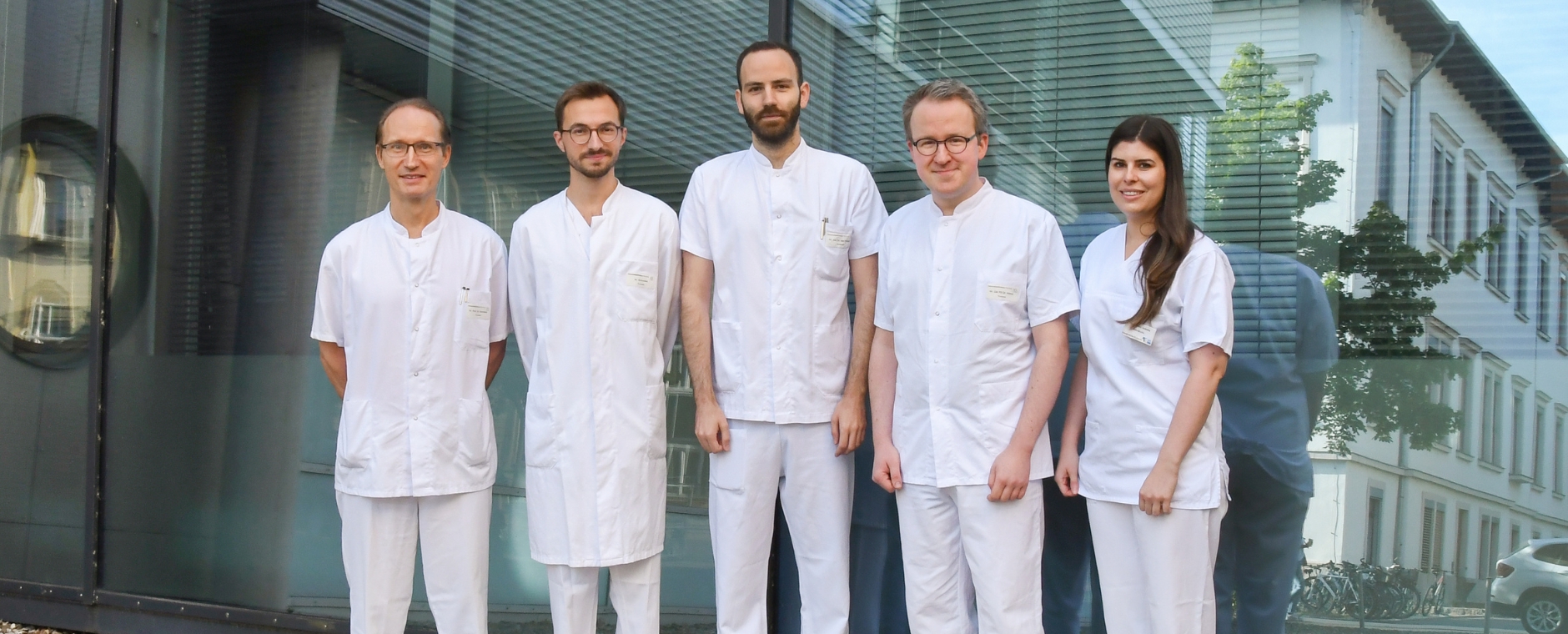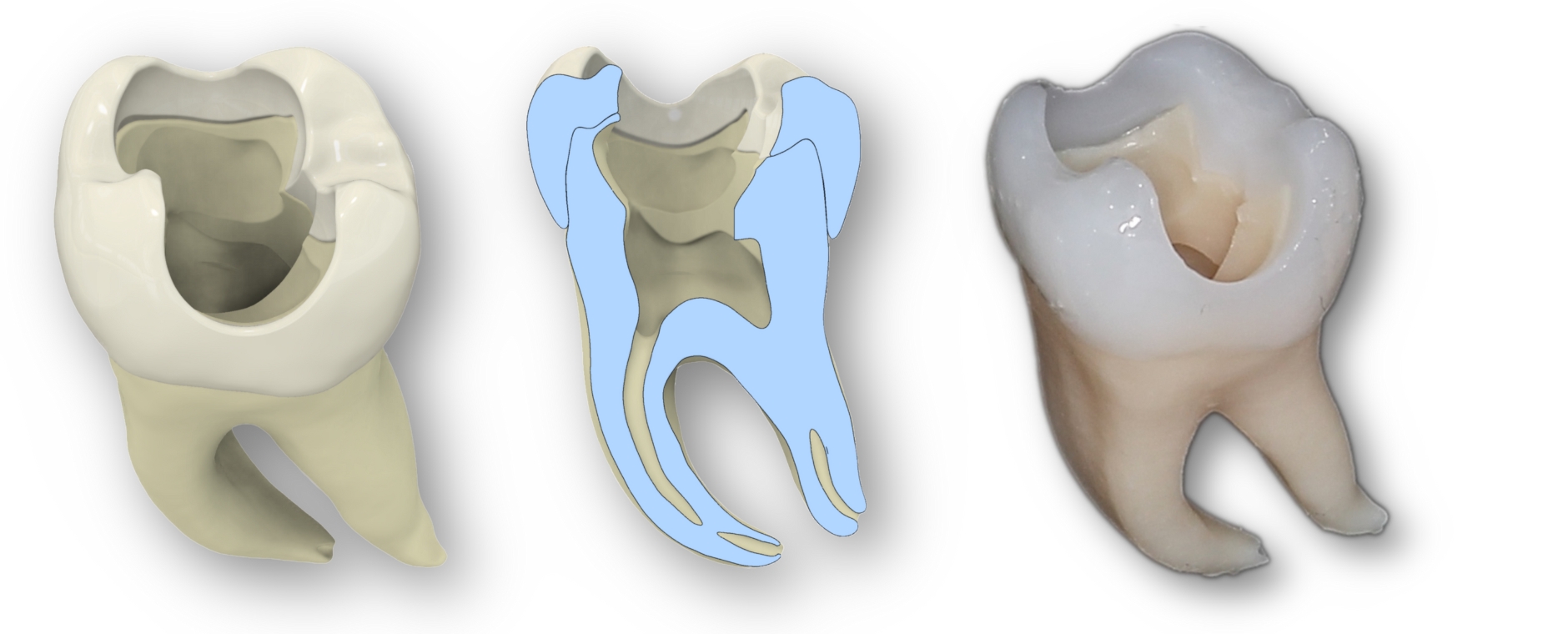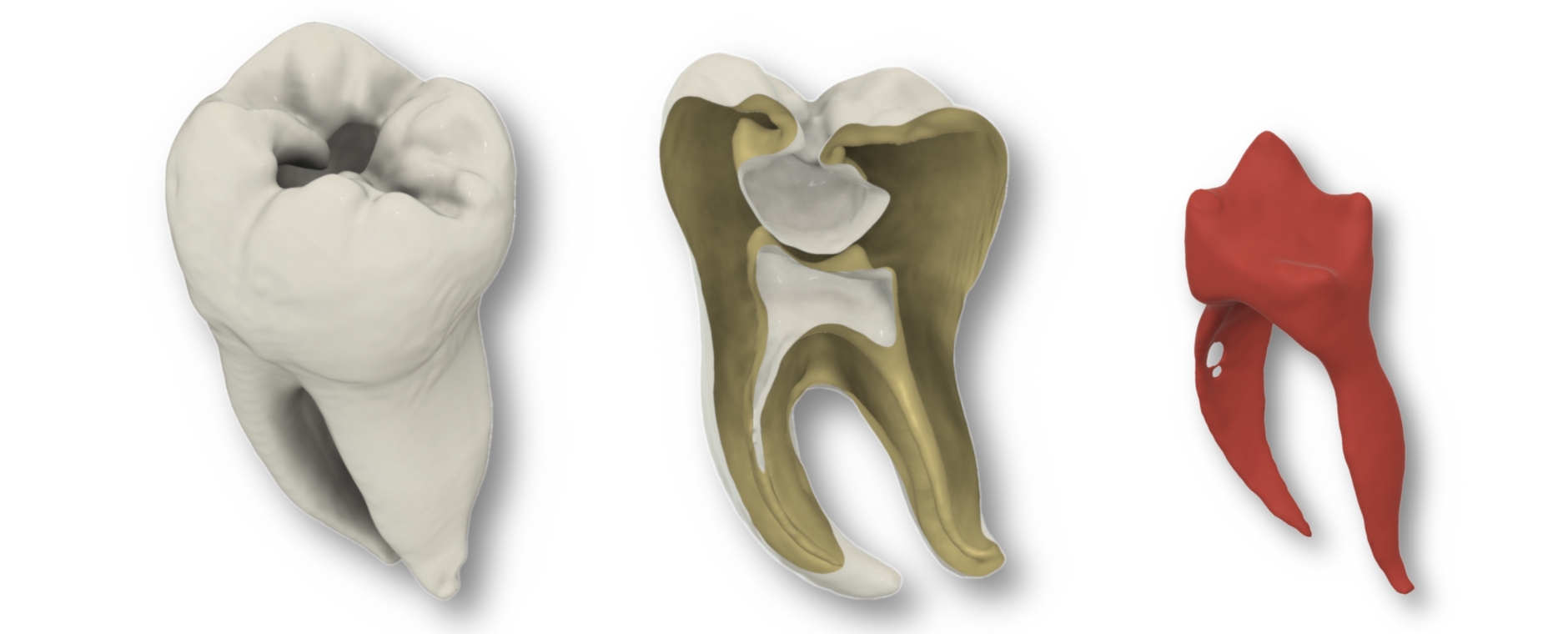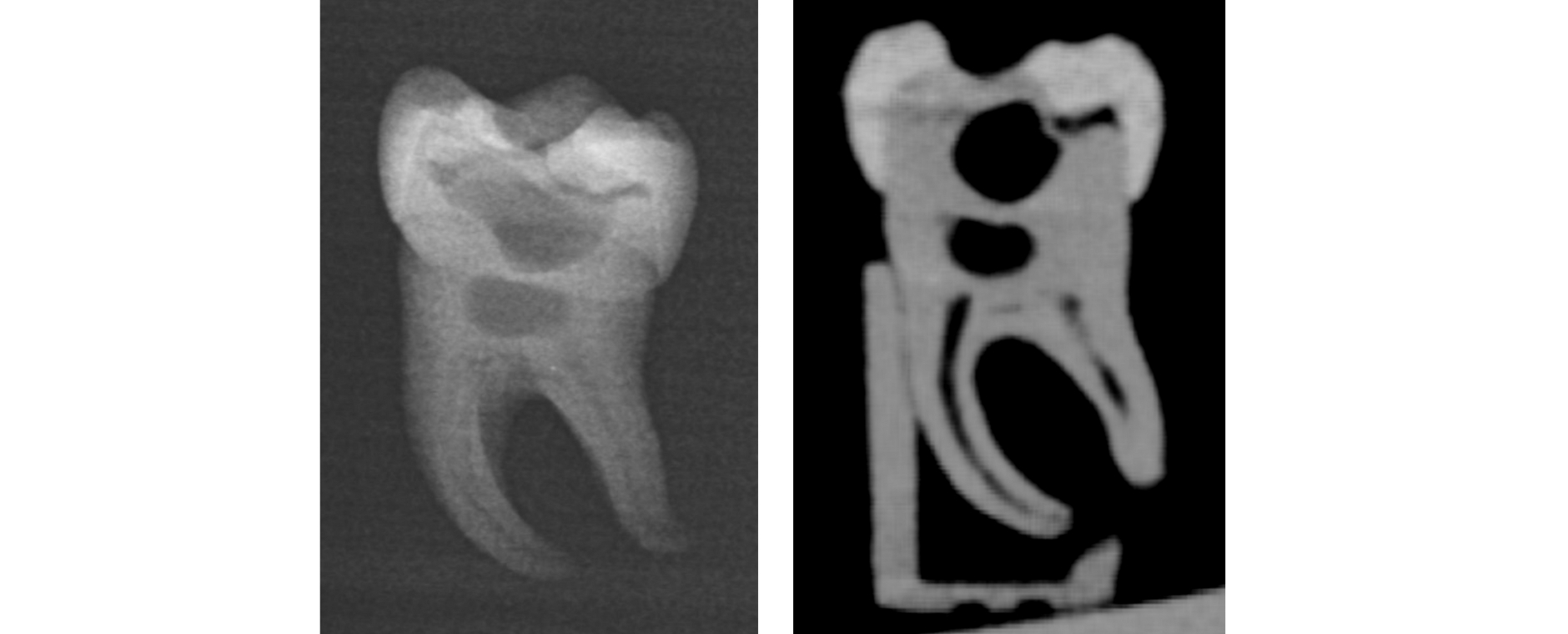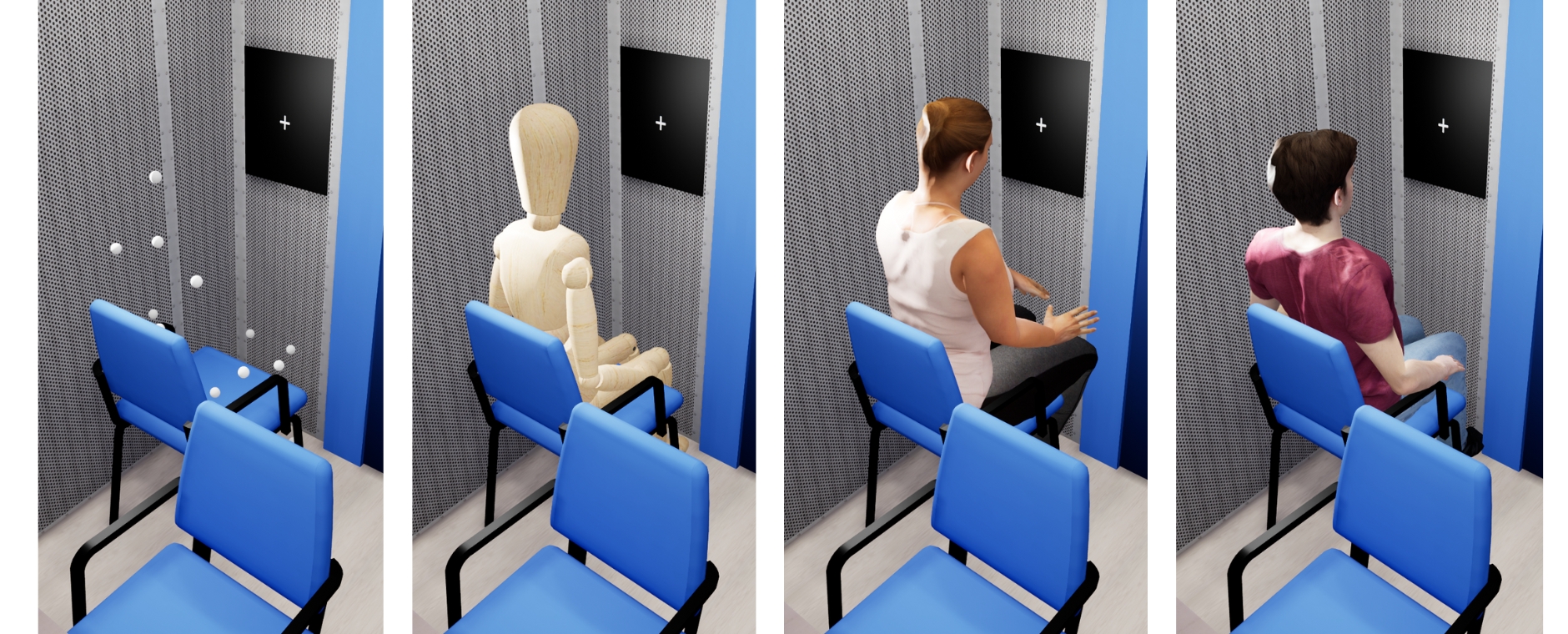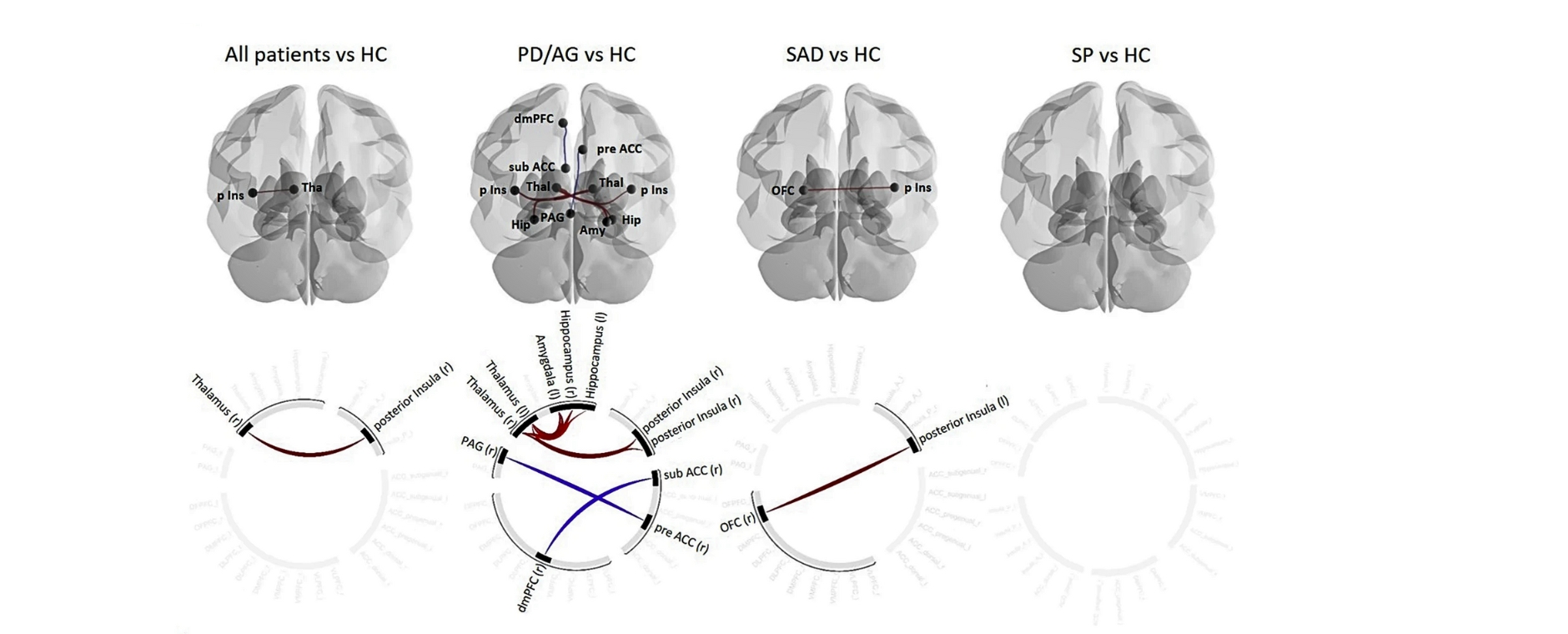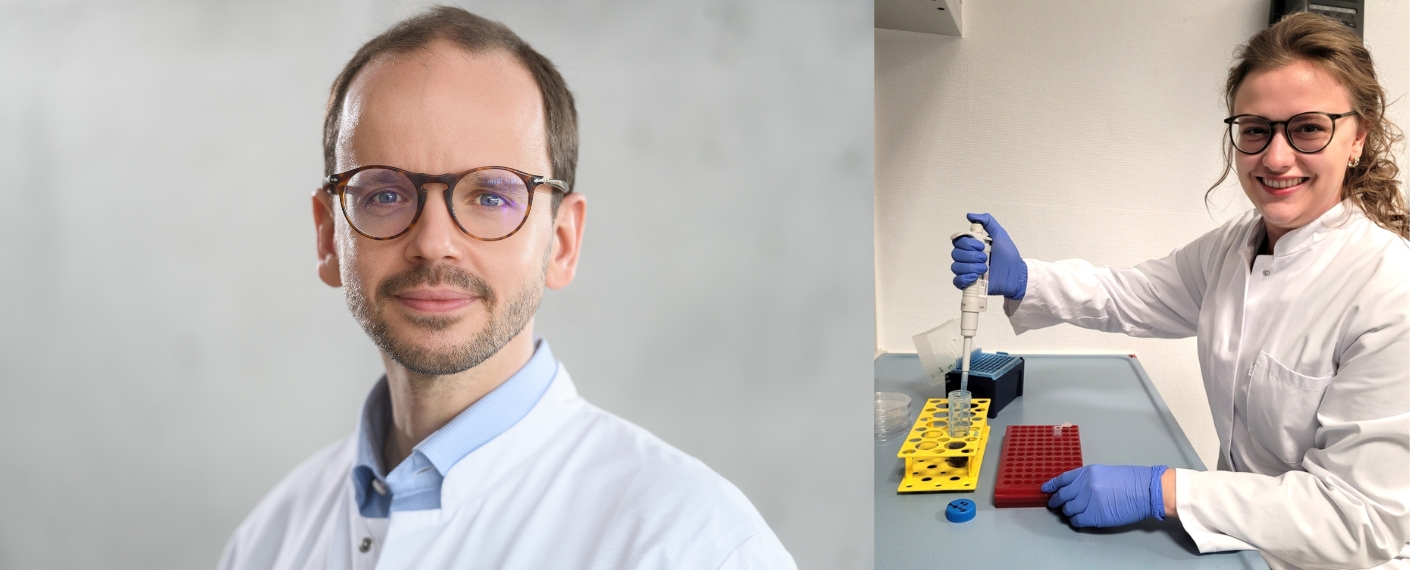
Eine Forschergruppe vom UKW und dem Klinikum der Universität München (LMU) untersuchte die Wirksamkeit von CDK4/6-Hemmern bei Darmkrebs - mit vielversprechenden Ergebnissen. Die einst für Brustkrebs entwickelten Medikamente bremsen auch das Wachstum von Darmkrebszellen wirksam, selbst bei therapieresistenten Tumoren. Entscheidend für den Therapieerfolg ist das Protein p16: Krebszellen mit hoher p16-Expression sprechen schlechter auf die Behandlung an. Das Protein könnte als Biomarker dienen, um Betroffene zu identifizieren, die besonders profitieren. Die von der Wilhelm Sander-Stiftung geförderte Studie wurde in der Fachzeitschrift „Cellular Oncology" publiziert und könnte den Weg für individualisierte Therapieansätze ebnen.
Weitere Informationen liefert die folgende Pressemeldung.
Publikation
Julia S. Schneider, Najib Ben Khaled, Liangtao Ye, Ralf Wimmer, Linda Hammann, Alexander Weich, Christoph Suppan, Ujjwal M. Mahajan, Andreas Jung, Jörg Kumbrink, Gerald Denk, Monika Rau, Volker Kunzmann, Solveig Kuss, Jens Neuman, Julia Mayerle, Andreas Geier, Heike M. Hermanns, Enrico N. De Toni & Florian P. Reiter. Efficacy of CDK4/6 Inhibition in colorectal cancer and the role of p16 expression in predicting drug resistance. Cell Oncol. 48, 1363–1375 (2025). https://doi.org/10.1007/s13402-025-01080-7