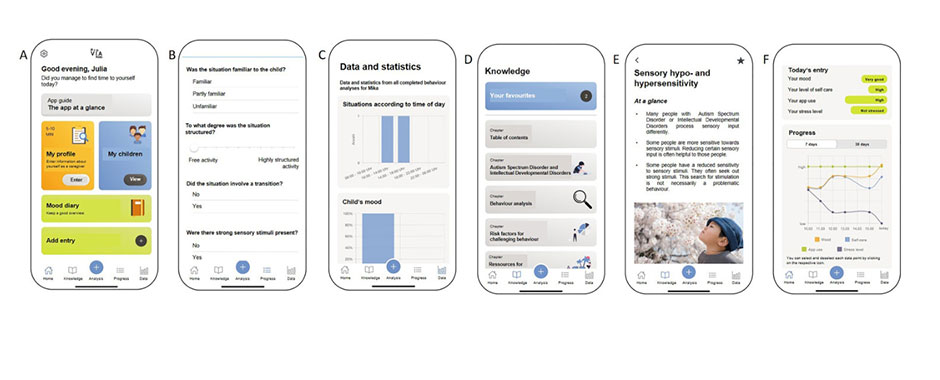Virale Atemwegsinfektionen sind nach wie vor weltweit ein großes Problem und verursachen zahlreiche Erkrankungen und Todesfälle.
Mit den in der MIAI-Geburtskohorte gesammelten Daten, Untersuchungsergebnissen und Bioproben will das Studienteam um Prof. Dr. Dorothee Viemann verstehen, wie Babys im ersten Lebensjahr lernen, sich gegen Viren wie Influenza, RSV oder SARS-CoV-2 zu verteidigen und warum manche Kinder anfälliger für schwere Virusinfektionen sind als andere. Die Pläne und das Design der MIAI-Studie sowie die Charakteristika der ersten 171 MIAI-Babys hat das Team vom Lehrstuhl Translationale Pädiatrie in der Fachzeitschrift Frontiers in Immunology veröffentlicht. Besonders hervorzuheben sei die Akzeptanz des Studiendesigns. Nur 9 Prozent haben abgebrochen, dazu zählen auch Familien, die aus Würzburg weggezogen sind. Generell sind die Eltern sehr engagiert, kommen gerne in die Studienambulanz, jetzt auch schon mit den ersten Geschwisterkindern. Das spricht für die Studie und das Studienteam.
Inzwischen hat die MIAI-Studienambulanz schon mehr als zweihundert Babys in ihre Geburtskohorte aufgenommen. Damit wurde ein wichtiger Meilenstein erreicht, um schon einige der Fragestellungen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projektes anzugehen.
Carina R. Hartmann, Robin Khan, Jennifer Schöning, Maximilian Richter, Maike Willers, Sabine Pirr, Julia Heckmann, Johannes Dirks, Henner Morbach, Monika Konrad, Elena Fries, Magdalene Winkler, Johanna Büchel, Silvia Seidenspinner, Jonas Fischer, Claudia Vollmuth, Martin Meinhardt, Janina Marissen, Mirco Schmolke, Sibylle Haid, Thomas Pietschmann, Simona Backes, Lars Dölken, Ulrike Löber, Thomas Keil, Peter U. Heuschmann, Achim Wöckel, Sagar, Thomas Ulas, Sofia K. Forslund-Startceva, Christoph Härtel, Dorothee Viemann. A clinical protocol for a German birth cohort study of the Maturation of Immunity Against respiratory viral Infections (MIAI). Frontiers in Immunology, Volume 15 - 2024. doi: 10.3389/fimmu.2024.1443665.