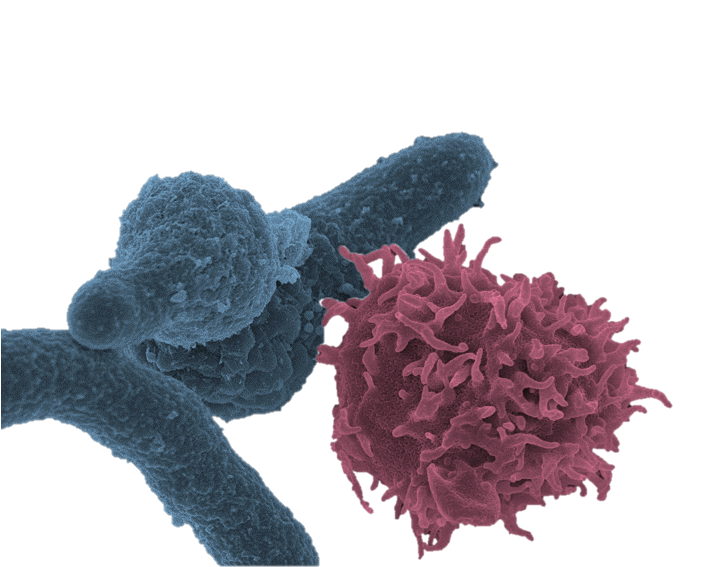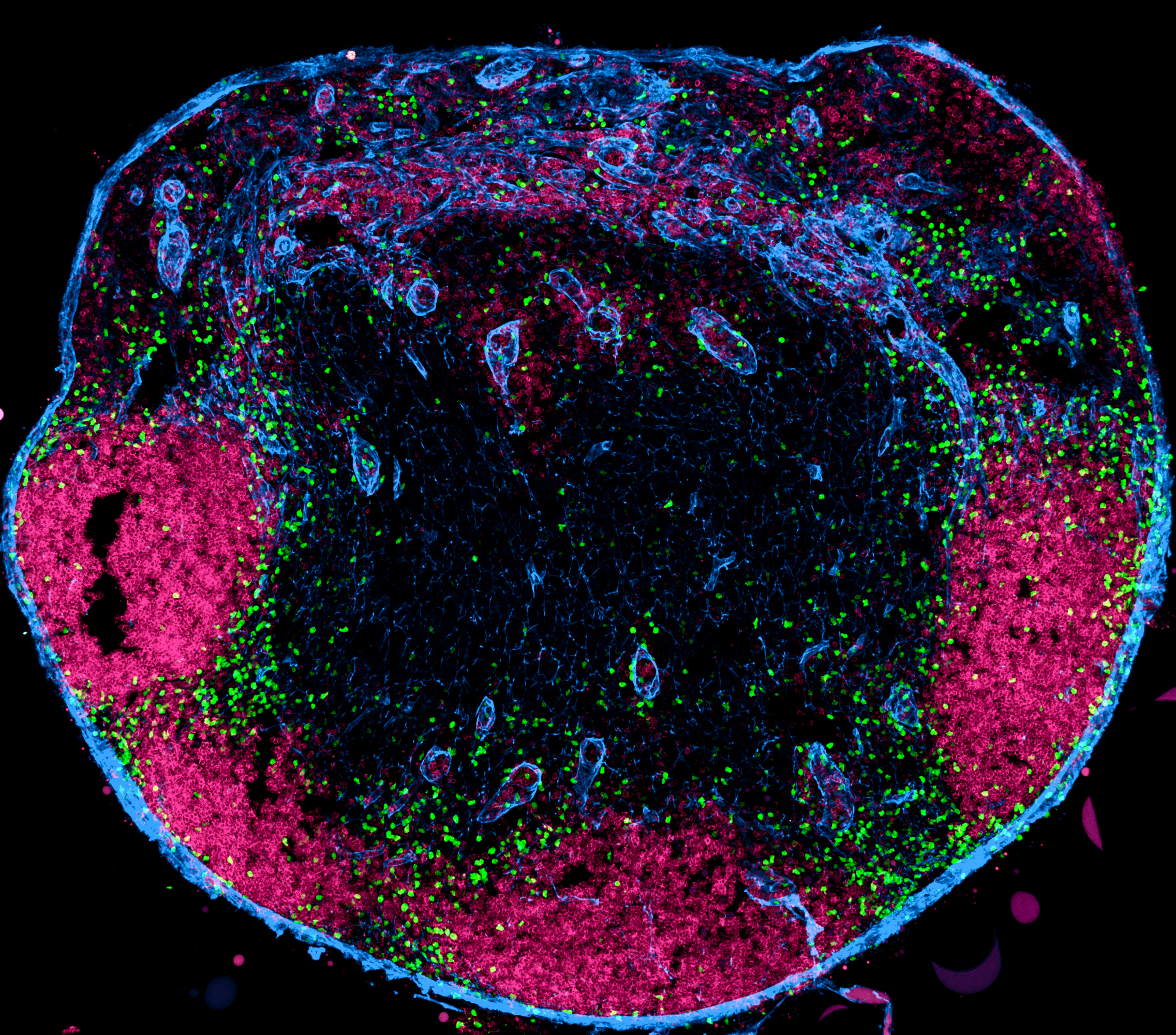Würzburg. Neben Impfen gehören Abstandhalten, Lüften, Maskentragen und Testen zu den wichtigsten Schutzmaßnahmen gegen die nächste, für den Herbst erwartete Corona-Welle. Große Hoffnung liegt wieder auf den unkomplizierten, weithin verfügbaren und kostengünstigen Antigen-Schnelltests, die vielen Aktivitäten Tür und Tor öffnen. Dass man sich bei einem negativen Schnelltest aber nicht immer in Sicherheit wiegen darf, zeigt die aktuellste am Universitätsklinikum Würzburg in Kooperation mit der Universität Würzburg und der Universität Greifswald durchgeführte Studie, die jetzt im Journal Clinical Microbiology and Infection veröffentlicht wurde.
In der bisher weltweit größten veröffentlichten klinischen Studie zu Antigen-Schnelltests hat das Team um Isabell Wagenhäuser und Dr. Manuel Krone die Sensitivität von Antigen-Schnelltests bei verschiedenen Varianten von SARS-CoV-2, darunter die aktuell vorherrschende Omikron-Variante, verglichen. Insgesamt wurden zwischen November 2020 und Januar 2022 bei 26 940 Personen 35 479 Parallel-Proben entnommen.
Ergebnis: Von 426 SARS-CoV-2-positiven PCR-Proben waren im Schnelltest nur 164 positiv. Das entspricht einer Sensitivität von lediglich 38,50 Prozent. Bei der derzeit vorherrschenden Omikron-Variante schlugen sogar nur 33,67 Prozent an. Beim Wildtyp zeigten immerhin 42,86 Prozent der Schnelltests einen positiven Befund.
Sensitivität hängt von Viruslast ab
„Wir konnten erwartungsgemäß beobachten, dass mit abnehmender Viruslast auch die Empfindlichkeit der Schnelltests abnahm“, berichtet Isabell Wagenhäuser. „Doch gerade bei einer hohen Viruslast wurden Omikron-Infektionen durch Antigen-Schnelltests schlechter erkannt.“ Studienleiter Manuel Krone fügt hinzu: „Die Viruslast, bei der Schnelltests mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent anschlagen, war bei Omikron-Infizierten 48-fach erhöht gegenüber dem Wildtyp-Virus. Diese zuvor in Laborstudien beobachtete Verringerung der Sensitivität konnten wir erstmals im klinischen Alltag nachweisen.“
Obwohl all diese Aspekte die Verwendung von Antigen-Schnelltests weiter einschränken, seien sie dem Autorenteam zufolge nach wie vor ein unersetzliches Diagnoseinstrument für ein schnelles, großflächiges SARS-CoV-2-Screening. Manuel Krone: „Schnelltests sind kein adäquater Ersatz für PCR-Untersuchungen bei symptomatischen Personen. Doch sie können potentielle Superspreader herausfiltern und somit dazu beitragen, die nächste Infektionswelle einzudämmen.“
Publikation: Isabell Wagenhäuser, Kerstin Knies, Daniela Hofmann, Vera Rauschenberger, Michael Eisenmann, Julia Reusch, Alexander Gabel, Sven Flemming, Oliver Andres, Nils Petri, Max S. Topp, Michael Papsdorf, Miriam McDonogh, Raoul Verma-Führing, Agmal Scherzad, Daniel Zeller, Hartmut Böhm, Anja Gesierich, Anna Katharina Seitz, Michael Kiderlen, Micha Gawlik, Regina Taurines, Thomas Wurmb, Ralf-Ingo Ernestus, Johannes Forster, Dirk Weismann, Benedikt Weißbrich, Lars Dölken, Johannes Liese, Lars Kaderali, Oliver Kurzai, Ulrich Vogel, Manuel Krone, Virus variant specific clinical performance of SARS-CoV-2 rapid antigen tests in point-of-care use, November 2020 to January 2022, Clinical Microbiology and Infection, 2022, ISSN 1198-743X, doi.org/10.1016/j.cmi.2022.08.006.