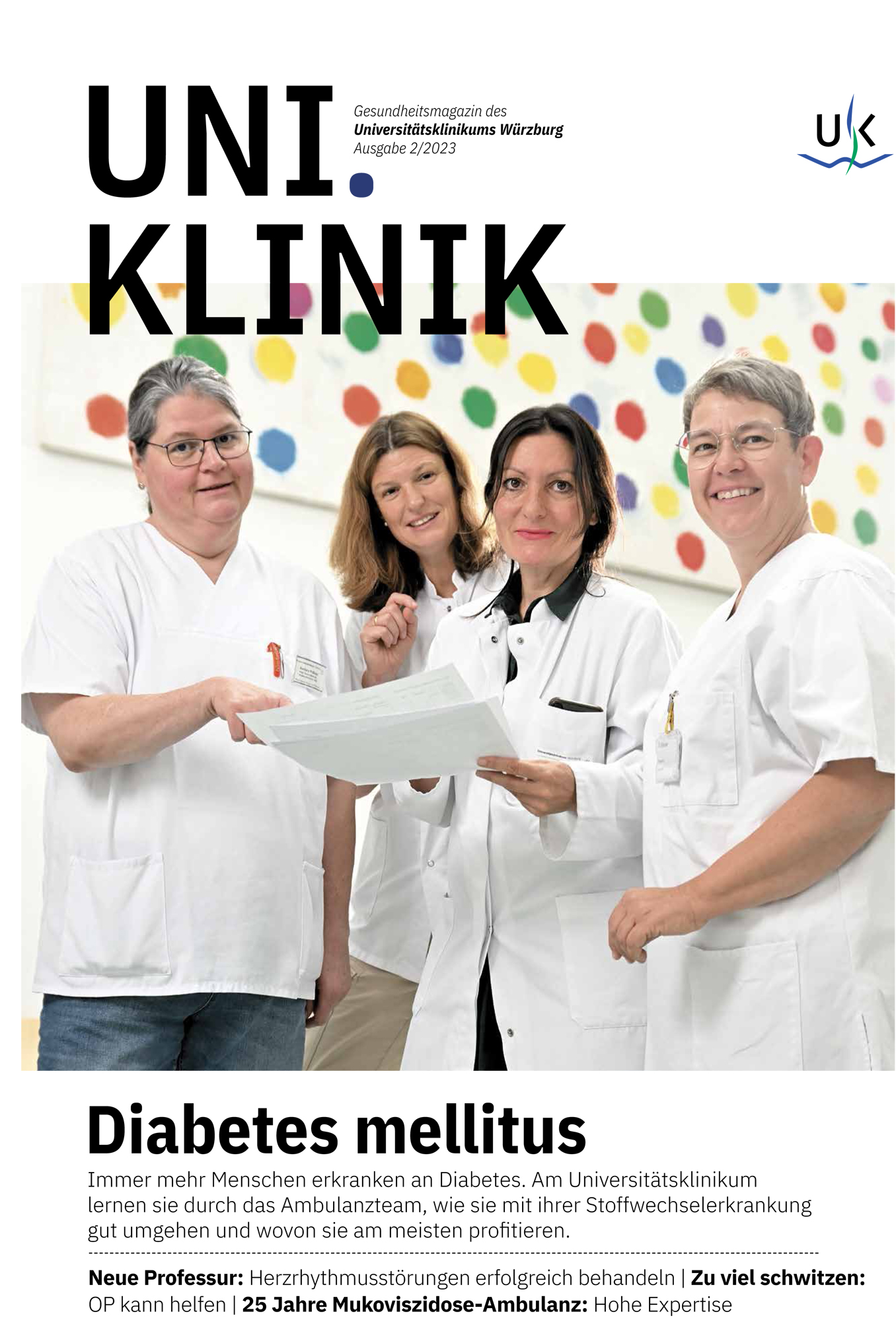Man muss vermutlich niemandem mehr erklären, welchen Fortschritt Wilhelm Conrad Röntgen der Medizin und damit auch der gesamten Menschheit mit seiner Entdeckung der nach ihm benannten Strahlen gebracht hat. Im Fall von Eduard Buchner und Emil Fischer dürfte das anders sein – obwohl auch sie für ihre Arbeiten mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurden.
Eduard Buchner (1860-1917) war Chemiker und erhielt 1907 den Nobelpreis für seine Entdeckung der zellfreien Gärung. Er zählt zu den Pionieren in der Erforschung von Enzymen und biochemischen Prozessen und trug mit seiner Arbeit wesentlich dazu bei, das Verständnis der Stoffwechselwege und biochemischen Prozesse in Zellen zu vertiefen. Dieses Wissen ist entscheidend für das Verständnis von Krankheiten und die Entwicklung von Medikamenten, da viele Arzneimittel auf spezifische biochemische Prozesse abzielen.
Auch Emil Fischer (1852-1923) war Chemiker. Er wurde 1902 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Fischer leistete bahnbrechende Arbeiten zur Zuckerchemie und gilt als Mitbegründer der klassischen organischen Chemie. Er entwickelte beispielsweise wichtige Konzepte wie die Fischer-Projektion, die zur Darstellung und Charakterisierung von Zuckerstrukturen verwendet werden. Dies war von großer Bedeutung für die Erforschung von Kohlenhydraten und deren Rolle in biologischen Prozessen und Krankheiten.
Würzburger Professoren und Nobelpreisträger
Was die drei gemeinsam haben – neben der Tatsache, dass sie Nobelpreisträger sind: Alle drei haben ein paar Jahre an der Universität Würzburg gelehrt und geforscht. Röntgen hatte hier von 1888 bis 1900 den Lehrstuhl für Physik inne, Buchner war von 1911 bis 1917 Inhaber des Lehrstuhls für Organische Chemie, Emil Fischer hatte von 1885 bis 1892 den Lehrstuhl für Chemie inne.
An ihr Wirken erinnern ab sofort drei neue Gedenktafeln, die jetzt im Zentrum Innere Medizin (ZIM) des Würzburger Universitätsklinikums in direkter Nachbarschaft zum Hörsaal feierlich enthüllt wurden.
Grußwort des Ärztlichen Direktors
„Diese drei Wissenschaftler waren herausragende Gelehrte, die in ihren jeweiligen Disziplinen Großartiges geleistet haben“, sagte Tim von Oertzen, der neue Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums, in seinem Grußwort anlässlich der Enthüllung der „Gelehrtentafeln“, wie sie in Würzburg genannt werden. Alle drei seien Wegbereiter der modernen Medizin, ohne sie seien viele Entwicklungen nicht denkbar gewesen.
Insgesamt zwölf Gelehrtentafeln hängen jetzt vor dem Hörsaal im Zentrum Innere Medizin. Sie sollen „historisches Bewusstsein erzeugen und auf die lange Tradition der Julius-Maximilians-Universität Würzburg hinweisen“, so von Oertzen. Gleichzeitig sollen sie Ansporn für die heutige und die kommende Generation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sein, auch in Zukunft weitere Rätsel zu lösen. Die Wand vor dem Hörsaal, in den täglich Studierende ein und aus gehen sei unter diesem Aspekt der ideale Ort.
Dank des Unipräsidenten
„Mit diesem Projekt wird die Geschichte der Universität Würzburg präsent und erfahrbar gemacht“, sagte Unipräsident Paul Pauli in seinem Grußwort. Sein besonderer Dank galt deshalb den Initiatoren der Aktion „Gelehrtentafeln“, den Würzburger Professoren August Heidland, Horst Brunner und Walter Eykmann, die für diesen Termin extra in die Universitätsklinik gekommen waren. Dank sprach Pauli auch dem Leiter des Universitätsarchivs, Marcus Holtz, und dessen Mitarbeiterin Edna Horst für ihren Einsatz bei der Umsetzung der Idee zur konkreten Tafel aus.
„Die lange Tradition der Universität Würzburg im Stadtbild sichtbar machen und an berühmte Wissenschaftler erinnern, die hier gelehrt und geforscht haben“: So lässt sich die Idee hinter den Gelehrtentafeln beschreiben, mit diesem Ziel lässt das Universitätsarchiv Gelehrtentafeln an Häusern und Einrichtungen im Würzburger Stadtgebiet anbringen, in denen früher einmal bekannte Wissenschaftler gewohnt oder gewirkt haben. Im Zentrum für Innere Medizin (ZIM), das Ende Juni 2009 in Betrieb genommen wurde, hat zwar keiner dieser Gelehrten gelebt oder geforscht. Hier weisen die Tafeln auf Professoren hin, die in verschiedenen Teildisziplinen der Medizin an der Universität Würzburg tätig waren und für die Medizin bedeutende Entdeckungen gemacht haben.
Das Projekt geht weiter
„Mit den Gelehrtentafeln wollen wir in der ganzen Stadt sichtbar machen, dass in Würzburg seit 600 Jahren herausragende Gelehrte exzellente Forschungsarbeit geleistet haben“, sagte Marcus Holtz in seinem Grußwort. Und er versprach, dass die nächste Reihe an Tafeln schon in absehbarer Zeit aufgehängt werde. Es habe zwar schon einmal den Punkt gegeben, an dem er gedacht habe: „Jetzt haben wir alle“, so Holtz. Dann seien aber immer wieder neue Namen aufgetaucht; das Projekt könne also weitergehen.
Walter Eykmann dankte zum Abschluss stellvertretend für die drei Initiatoren allen an der Erstellung der Gelehrtentafeln Beteiligten. Und August Heidland ergänzte: „Gedenktafeln gibt es zwar auch in anderen Städten. Wir aber haben die schönsten!“
Mit den drei neuen Gelehrtentafeln erhöht sich die Gesamtzahl dieser Erinnerungsorte im Würzburger Stadtgebiet jetzt auf 57 Tafeln. Mehr Informationen dazu stehen auf den Webseiten des Universitätsarchivs.
Kontakt
Dr. Marcus Holtz, Universitätsarchiv Würzburg, T: +49 931 31-86032, uniarchiv@ uni-wuerzburg.de