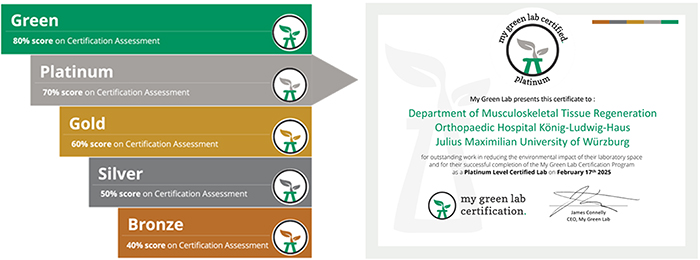Würzburg. Das maligne Melanom, auch „schwarzer Hautkrebs“ genannt, zählt zu den aggressivsten Hauttumoren. Es weist die höchste Metastasierungsrate auf und ist die Ursache für den Tod von jährlich rund 3.000 Betroffenen in Deutschland. Fortschritte in der Behandlung wie zum Beispiel moderne Immuntherapien haben zwar die Überlebenschancen vieler Betroffener verbessert. „Doch bei jedem zweiten Patienten schlagen die Immuncheckpoint-Inhibitoren nicht an“, berichtet Dr. Julia Krug. Die 35-jährige Naturwissenschaftlerin aus der Dermatologie des Uniklinikums Würzburg (UKW) möchte die Erfolgsrate der Immuntherapien erhöhen. Für ihr Projekt „Überwindung der Anti-PD-1-Therapieresistenz durch gezielte Behandlung nicht ansprechender Melanome mit Mifepriston-Biokonjugaten“ hat sie gerade das Young Scientist Fellowship des Bayerischen Zentrums für Krebsforschung (BZKF) erhalten.
„Ich hatte mich schon riesig gefreut, dass mein Projekt im lokalen Auswahlprozess Beachtung fand. Dass ich dann auch noch ausgewählt wurde, meine Arbeit vor einem standortübergreifenden Gremium in einer zehnminütigen Präsentation vorzustellen, und schließlich sogar das Stipendium gewonnen habe, ist eine tolle Wertschätzung meiner Arbeit“, so die Preisträgerin. Insgesamt wird an den sechs bayerischen Unikliniken jeweils ein Projekt für die Dauer eines Jahres mit 100.000 Euro gefördert.
Neue Strategien zur Überwindung der Anti-PD-1-Therapieresistenz bei malignen Melanomen
Um ihr Vorhaben zu schildern, holt Julia Krug etwas aus. Im Jahr 2018 wurde der Nobelpreis an zwei Forscher verliehen, die die Immuntherapien, insbesondere die Checkpoint-Inhibitoren, revolutioniert haben. James P. Allison entdeckte das immunhemmende Molekül CTLA-4 und Tasuku Honjo den Rezeptor PD-1, der ähnlich wie CTLA-4 die T-Zell-Aktivierung hemmt. Wenn Krebszellen den passenden Liganden auf ihrer Oberfläche tragen, können sie sich mit dem entsprechenden Bremsmolekül auf den Immunzellen verbinden und diese stilllegen. Auf Basis dieser grundlegenden Erkenntnisse wurden Checkpoint-Inhibitoren entwickelt, also Medikamente, die verhindern, dass Krebszellen die „Immunbremse“ ziehen. Dadurch wird das patienteneigene Immunsystem reaktiviert und kann seiner eigentlichen Aufgabe nachkommen, den Krebs wirksam zu bekämpfen.
Bremsende Makrophagen umprogrammieren
Damit die Anti-PD-1-Therapie bei mehr als der Hälfte der Patientinnen und Patienten anschlägt, konzentriert sich Julia Krug auf bestimmte Zellen des Immunsystems: die Makrophagen. Der Begriff setzt sich aus den altgriechischen Wörtern makrós für „groß” und phagein für „fressen” zusammen und bedeutet „Riesenfresszellen”. Sie fressen und verdauen alles, was für den Körper potenziell gefährlich oder überflüssig ist. Zudem rekrutieren sie andere Immunzellen zur Unterstützung im Kampf gegen den Krebs. „Es gibt jedoch auch Makrophagen, die im Tumormikromilieu zu ‚Bad Guys‘ geworden sind und das Immunsystem derart bremsen, dass der Tumor weiterwachsen kann. Diese wollen wir finden und wieder zu ‚Guten‘ bekehren“, erläutert Julia Krug.
Prof. Dr. Astrid Schmieder, die Leiterin der Arbeitsgruppe Immundermatologie am UKW, hatte bereits Vorarbeit geleistet und verschiedene Marker für die immunsuppressiven Makrophagen entdeckt. „Dabei ist uns ein bestimmter Signalweg aufgefallen. Wenn wir diesen unterdrücken können, dann ändern die Makrophagen ihre Funktion und bekämpfen wieder den Tumor“, erklärt Astrid Schmieder, die sichtlich stolz auf ihre erfolgreiche Postdoktorandin ist. Die beiden Wissenschaftlerinnen werden oft als „Power Couple“ bezeichnet. Was sie eint, wie sie den Weg in die Forschung gefunden haben und mit welcher Leidenschaft sie ihren Projekten nachgehen, ist in den Porträts der Serie #WomenInScience nachzulesen.
Ein Kubikmillimeter kleine Quader aus Tumorprobe
Der Wirkmechanismus, der verhindert, dass der unheilvolle Signalweg in Makrophagen aktiviert wird, hat sich bereits in speziellen Mausmodellen bewährt. Nun möchte Julia Krug ihn an humanen Gewebeproben untersuchen. Hierzu arbeitet sie einerseits mit Melanom-Zelllinien aus den 1970er Jahren, andererseits mit frischem OP-Material. Letzteres wird in ein Kubikmillimeter kleine Quader geschnitten. Das entspricht der Größe eines Staubkorns oder einem Dreißigstel eines Wassertropfens. Diese Quader bringt sie dann mit ihren behandelten Makrophagen in eine Zellkultur, gibt Inhibitoren darauf und sieht innerhalb von drei Tagen, ob das Material auf die Therapie anspricht. „Und da wir ganz viele Quader aus dem Tumor haben, können wir weitere Mechanismen, Methoden und Behandlungsstrategien testen und die Ansprechrate vorhersagen“, schwärmt Julia Krug von diesem „tollen Tool“.
Bis dieser Ansatz jedoch standardisiert ist und man anhand einer winzigen Tumorprobe die optimale Behandlung für jede Patientin und jeden Patienten bestimmen kann, wird noch viel Forschungsarbeit nötig sein.
Doch Julia Krug, frischgebackene Mutter eines sieben Monate alten Sohnes, ist voller Tatendrang. Im Januar übernimmt ihr Mann die Elternzeit und damit die Care-Arbeit, sodass sie mit dem finanziellen Rückenwind des BZKF wieder voll im Labor durchstarten kann.
BZKF-Young Scientist Fellowship
„Das Programm des BZKF ist für Young Scientist Fellows sehr wichtig. Denn die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erhalten durch die Förderung die notwendigen finanziellen Mittel und als Clinician Scientists oftmals auch die nötigen Freiräume für die Forschung“, betont Prof. Ralf Bargou. Dem Direktor des Comprehensive Cancer Center Mainfranken (CCC MF) und Mitglied des BZKF-Direktoriums liegt die Förderung des Nachwuchses sehr am Herzen. Bei der Übergabe der Urkunde gratulierte er Julia Krug zur hochverdienten Auszeichnung. „Die immunonkologische Forschung – sowohl präklinisch als auch klinisch – ist in Würzburg und in WERA stark vertreten. Es gibt viele Ansätze, um Resistenzen zu überwinden, die vor allem beim malignen Melanom hochrelevant sind. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse.“
Das Young Scientist Fellowship des Bayerischen Zentrums für Krebsforschung (BZKF) ist ein Förderprogramm für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die innovative Projekte in der Krebsforschung durchführen möchten. Ziel ist es, vielversprechende Nachwuchstalente in Bayern zu unterstützen und ihnen zu ermöglichen, eigene translational ausgerichtete Forschungsprojekte umzusetzen. Dabei handelt es sich um Vorhaben, die eine Brücke zwischen Grundlagenforschung und klinischer Anwendung schlagen. Das Stipendium richtet sich an Medical Scientists, Clinician Scientists, Clinical Trialists sowie junge Forschende aus den Bereichen Medizin, Lebens- und Naturwissenschaften. Voraussetzung ist, dass das Projekt an einem der BZKF-Standorte in Bayern angesiedelt ist. Pro Person werden 100.000 Euro für zwölf Monate gefördert, und pro Ausschreibungsrunde werden sechs solcher Fellowships vergeben, jeweils eines am BZKF-Standort. Die Auswahl erfolgt in einem zweistufigen Verfahren: Zunächst finden lokale Auswahlprozesse an den sechs beteiligten Universitätskliniken statt. Anschließend folgt eine zentrale Finalrunde mit Präsentationen vor einem standortübergreifenden Gremium, in dem auch Patientenvertreterinnen und -vertreter sowie ehemalige Fellows sitzen. Neben der finanziellen Unterstützung bietet das Programm die Einbindung in das wissenschaftliche Netzwerk des BZKF und Fördermaßnahmen für die langfristige Karriereentwicklung.
Text: Kirstin Linkamp / Wissenschaftskommunikation
Link zur Pressemeldung des BZKF
Link zum #WomenInScience-Porträt von Julia Krug