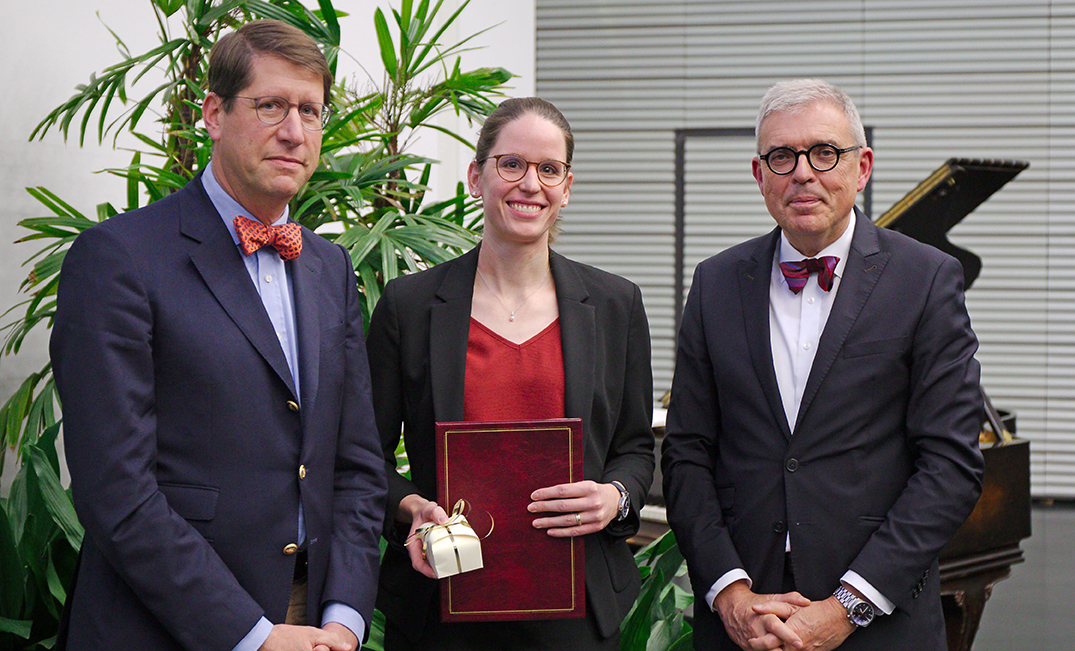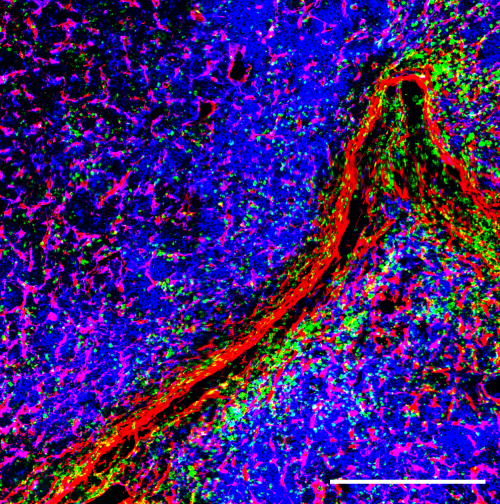Würzburg. Herzinsuffizienz ist in Deutschland die häufigste Einzeldiagnose bei Klinikaufnahmen und hat eine ernste Prognose: nur jede zweite Person mit Neudiagnose Herzinsuffizienz wird die folgenden fünf Jahre überleben. Eine frühzeitige, medizinische Therapie kann jedoch stationäre Aufenthalte reduzieren, Lebensqualität verbessern und die Überlebenswahrscheinlichkeit nachweislich erhöhen. Vor allem die Herzinsuffizienz mit reduzierter Pumpfunktion (HFrEF: heart failure with reduced ejection fraction) lässt sich inzwischen gut medikamentös behandeln. Die European Society of Cardiology (ESC) empfiehlt mit höchstem Nachdruck in ihren Leitlinien die Therapie mit vier Wirkstoffgruppen inklusive der beiden neuen Substanzklassen ARNI und SGLT2-Hemmer*, deren zusätzlicher Nutzen in mehreren Studien demonstriert wurde.
Doch wie gut und schnell wird die neue Evidenz für diese neuartigen medikamentösen Therapien gemäß Leitlinien eigentlich in die tägliche Praxis umgesetzt? Und wie hat sich COVID-19-Pandemie auf die Verordnungsraten in der Herzinsuffizienz-Versorgung ausgewirkt? Ein Team namhafter Wissenschaftler unter der Leitung von Prof. Dr. Stefan Störk vom Deutschen Zentrum für Herzinsuffizienz Würzburg (DZHI) am Uniklinikum Würzburg (UKW) hat sich die Verschreibungspraxis im Zeitraum 2016 bis 2023 genauer angeschaut und ihre Analysen jetzt im Fachjournal THE LANCET Regional Health Europe veröffentlicht. Im Fokus standen dabei die beiden neuen Wirkstoffklassen ARNI und SGLT2-Inhibitor. ARNI ist die Kombination aus dem Neprilysin-Inhibitor Sacubitril und dem Angiotensin-Rezeptor-Blocker Valsartan, das die europäischen Arzneimittelbehörde EMA im November 2015 zugelassen hat. SGLT2-Inhibitoren sind seit August 2021 in den Leitlinien empfohlen.**
Verschreibungszahlen brachen zu Beginn der Covid-19-Pandemie ein
Konkret untersucht wurden Apothekendaten aus der Verschreibungsdatenbank IQVIA. Die Anzahl der Menschen, die mit Sacubitril/Valsartan behandelt wurden, stieg kontinuierlich an, von 5.260 im ersten Quartal 2016 auf 351.262 im zweiten Quartal 2023. Zeitgleich mit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie verlangsamte sich das vierteljährliche Wachstum jedoch erheblich, um etwa 50 Prozent von 16.507 im ersten Quartal 2020 auf 8.804 im darauffolgenden Quartal.
Ähnlich verhielt es sich bei den Neuverschreibungen. Diese stiegen zwar insgesamt von 5.238 im ersten Quartal 2016 auf 53.534 Verordnungen bis zum zweiten Quartal 2023. Zu Beginn der Pandemie, im Übergang vom ersten zum zweiten Quartal 2020 gingen die Verschreibungen von Sacubitril/Valsartan jedoch um 17,5 Prozent zurück (von 26.855 in Q1/2020 auf 22.145 in Q2/2020). Erst ein knappes Jahr später, im ersten Quartal 2021, wurde mit 27.197 Neuverschreibungen das Niveau vor der Pandemie erreicht. „In den klinischen Studien zu diesem Präparat haben wir gelernt, dass selbst stabile Patientinnen und Patienten mit Herzinsuffizienz von der Therapie mit Sacubitril/Valsartan im ersten Jahr deutlich profitiert haben. Der um ein Jahr verzögerte oder ausgesetzte Beginn dieser wichtigen Arzneimitteltherapie ist also für die Alltagsversorgung sehr relevant“, kommentiert Prof. Dr. Stefan Störk.
50.000 weniger kardiologische Konsultationen in einer Woche
Die vorliegende Analyse bestätigt die Ergebnisse einer umfassenden Übersichtsarbeit, die 81 Studien aus 20 Ländern berücksichtigt und einen pandemiebedingten Rückgang der Inanspruchnahme des Gesundheitssystems insgesamt um 37 Prozent und für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 29 Prozent aufzeigt. Das passt auch zum Trendreport des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland. Demnach sanken in Deutschland die Behandlungsfälle in kardiologischen Praxen in der letzten Märzwoche 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent, was 50.000 weniger Konsultationen in einer Woche bedeutet, und in allgemeinmedizinischen Praxen um 39 Prozent, was 500.000 weniger Konsultationen entspricht.
Resilienz der Gesundheitssysteme bei Pandemien und anderen Krisen stärken
„Unsere Daten verdeutlichen die negativen Folgen der Pandemie, einschließlich der Lockdown-Maßnahmen, und legen nahe, dass wir die Resilienz, also die Widerstandskraft unseres Gesundheitssystems stärken müssen, um uns für zukünftige Gesundheitskrisen zu wappnen. Es müssen Maßnahmen getroffen werden, um den Zugang zu lebensnotwendigen Medikamenten sowie zur Gesundheitsversorgung insgesamt für Patientinnen und Patienten mit chronischen Erkrankungen sicherzustellen. Das betrifft zukünftige Pandemien, kann aber prinzipiell auch auf andere Krisen der öffentlichen Gesundheit, wie beispielsweise Extremwetterereignisse beziehungsweise Überschwemmungen übertragen werden,“ fasst Dr. Fabian Kerwagen zusammen. Der angehende Kardiologe spezialisiert sich im DZHI auf die Versorgungsforschung und ist als Erstautor der Publikation „Impact of the COVID-19 pandemic on implementation of novel guideline-directed medical therapies for heart failure“.
Neue Leitlinien finden relativ schnell den Weg in die Praxis
Als äußerst positiv bewerten die Autoren die schnelle Umsetzung der neuen Leitlinien-Empfehlungen. „Wir haben gesehen, dass sowohl Sacubitril/Valsartan als auch die SGLT2-Hemmer nach Zulassung und Leitlinienempfehlung zunehmend rascher in der Versorgungsrealität ankommen und verschrieben werden“, stellt Fabian Kerwagen zufrieden fest.
So konnte das Studienteam direkt nach der Zulassung des ersten SGLT2-Inhibitors für HFrEF Ende 2020 einen Anstieg der gemeinsamen Verschreibung von SGLT2-Inhibitor mit Sacubitril/Valsartan nachweisen. Dieser Trend beschleunigte sich mit den neuen ESC-Leitlinien zur Herzinsuffizienz. Das vierteljährliche Wachstum für die Kombinationstherapie verdoppelte sich nahezu von 11.929 im dritten Quartal 2021 auf 22.033 im darauffolgenden Quartal und nahm danach weiter kontinuierlich zu. Zuletzt, im zweiten Quartal 2023, wurde die Kombinationstherapie (S/V und SGLT2-Inhibitor) 80.926 mal verordnet. Allerdings: Frauen und Patienten im Alter von über 80 Jahren wurden seltener mit einer Kombinationstherapie behandelt als Männer und jüngere Patienten.
„Obwohl klinische Leitlinien zu einem immer besser angenommenen Eckpfeiler der klinischen Versorgung geworden sind, bestehen nach wie vor große Lücken zwischen der Evidenz aus den entscheidenden randomisierten Ergebnisstudien und der Akzeptanz der leitliniengerechten medikamentösen Therapie in der täglichen Praxis. Letztendlich sind noch erhebliche Anstrengungen erforderlich, um zu verstehen, wie evidenzbasiertes klinisches Wissen effektiver in die Praxis umgesetzt und genutzt werden kann“, fasst Stefan Störk zusammen.
*Angiotensin-Rezeptor-Neprilysin-Inhibitoren (ARNI), Natrium-Glukose-Co-Transporter-2-Inhibitoren (SGLT2-Hemmer)
** Im Juni 2021 hatte Empagliflozin nach Dapagliflozin als zweiter SGLT-2-Hemmer die Zulassungserweiterung für HFrEF erhalten.
Publikation:
Fabian Kerwagen, Uwe Riemer, Rolf Wachter, Stephan von Haehling, Amr Abdin, Michael Böhm, Martin Schulz, Stefan Störk. Impact of the COVID-19 pandemic on implementation of novel guideline-directed medical therapies for heart failure in Germany: a nationwide retrospective analysis. The Lancet Regional Health - Europe, Volume 35, 2023, 100778,
ISSN 2666-7762, https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2023.100778.
WHO / Europe ruft zu #Preparedness2.0 auf
Parallel zur Veröffentlichung der Studie fand in Istanbul die dritte Tagung der Fachberatungsgruppe (TAG für Technical Advisory Group) zur Entwicklung der Strategie und des Aktionsplans #Preparedness2.0 für gesundheitliche Notfallvorsorge, Reaktionsfähigkeit und Resilienz in der Europäischen Region der WHO statt.
Die Mitglieder der TAG, die die Vielfalt der Region sowie Geschlecht, Alter und disziplinäre Hintergründe widerspiegeln, wurden vom WHO-Regionaldirektor für Europa, Dr. Hans Henri P. Kluge, im Juni 2023 ernannt, nachdem von März bis Mai 2023 eine Reihe offener Aufforderungen zur Einreichung von Expertenvorschlägen veröffentlicht worden waren.
Für die Zukunft wird die „pandemic preparedness“ von entscheidender Bedeutung sein. Wie in den jüngsten gesundheitspolitischen Studien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hervorgehoben wird, muss die Gesundheitspolitik angemessene Maßnahmen ergreifen, um bei künftigen Krisen Unterbrechungen der Versorgungskontinuität von Patientinnen und Patienten mit chronischen Erkrankungen zu verhindern oder abzumildern und letztlich die Resilienz der Gesundheitssysteme zu stärken.