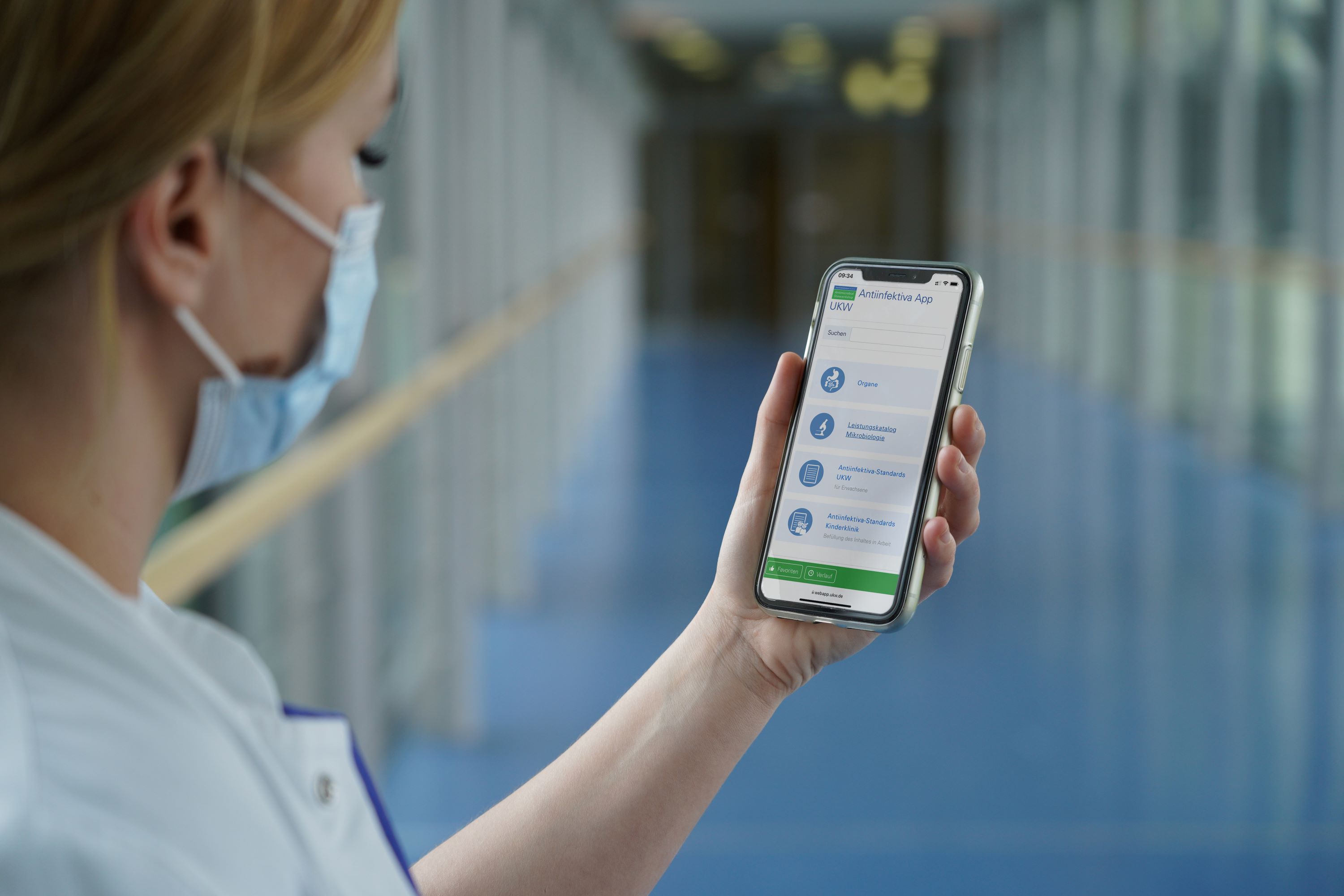Würzburg/Erlangen/Regensburg/Augsburg: Am 24. November haben die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger, Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Petra Olschowski sowie Vertreterinnen und Vertreter der Ministerien aus Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Sachsen in Heidelberg die Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung zur NCT-Erweiterung unterzeichnet. Das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) wurde bundesweit um vier neue Standorte erweitert. Diese sind Berlin, SüdWest (Tübingen/Stuttgart-Ulm), WERA (Würzburg mit den Partnern Erlangen, Regensburg und Augsburg) und West (Essen/Köln). Mit den schon bestehenden Standorten Heidelberg und Dresden kooperieren nun insgesamt sechs NCT-Standorte mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) und der Universitätsmedizin. Erklärtes Ziel ist es, modernste klinische Krebsforschung in Deutschland nachhaltig voranzubringen und hierdurch die Behandlungsergebnisse und Lebensqualität von Krebspatientinnen und -patienten zu verbessern.
WERA-Partner decken Versorgungsgebiet von rund acht Millionen Menschen ab
„Mit der Einrichtung des NCT wird eine neue Ära für die translationale Krebsforschung am Wissenschaftsstandort Deutschland eingeläutet“, kommentiert Prof. Dr. Hermann Einsele, Sprecher Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen NCT WERA und Direktor der Medizinischen Klinik und Poliklinik II am Universitätsklinikum Würzburg. „Wir sind sehr glücklich und auch etwas stolz, dass wir nun Teil des erweiterten NCT sind“, freut sich Prof. Dr. Wolfgang Herr, Stellvertretender Sprecher des NCT WERA und Direktor der Klinik für Innere Medizin III am Uniklinikum Regensburg.
Mit dem NCT WERA werde gerade im nordbayerischen Raum die Möglichkeit geschaffen, neueste Verfahren in der Diagnostik und Therapie von Krebserkrankung auch in der Fläche anzubieten. Die vier WERA-Partner decken ein Versorgungsgebiet von rund acht Millionen Menschen ab. „Durch die NCT-Förderung erhalten alle Krebspatientinnen und -patienten, auch jene aus vorwiegend ländlichen Gebieten, an den WERA-Standorten den bestmöglichen Zugang zu modernsten onkologischen Diagnostik- und Therapieverfahren sowie zu innovativen klinischen Studien“, sagt Wolfgang Herr.
Nachwuchs erhält geschützten Freiraum für die Forschung
Und auch für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stellt Hermann Einsele zufolge das NCT eine großartige Möglichkeit dar, die Erkenntnisse aus den Grundlagenwissenschaften und aus der präklinischen Forschung in die Klinik transferieren zu können: „Die Nachwuchsforschung wird mit vielen neuen Positionen für forschungsorientierte Kolleginnen und Kollegen und neuen Karriereoptionen deutlich ausgebaut. Schließlich wird das NCT ‚protected time‘ ermöglichen, um Studienideen oder Forschungsvorhaben von jungen Ärztinnen und Ärzten in die Klinik zu bringen.“
Neueste Erkenntnisse rasch und flächendeckend in klinische Studien bringen
Die Bedeutung der Nachwuchsförderung aber auch der Translation verdeutlichte Privat-Dozentin Dr. Sophia Danhof vom Universitätsklinikum Würzburg im Rahmen der Podiumsdiskussion, die kurz vor der Unterzeichnung der Bund-Länder-Vereinbarung stattfand: „Wo in der Vergangenheit exzellente präklinische Forschung nicht oder nur unzureichend die klinische Anwendung erreicht hat, bündelt das NCT nun alle Kräfte, um Krebspatientinnen und -patienten die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse möglichst rasch und flächendeckend in klinischen Studien zugutekommen zu lassen. Das NCT beflügelt so die Translation deutscher Spitzenforschung in onkologische Hochleistungsmedizin ‚made in Germany‘“, so die Internistin und Forschungsgruppenleiterin am Lehrstuhl für Zelluläre Immuntherapie.
Konkret sollen im NCT WERA die Entwicklung neuer Krebsmedikamente und die auf den einzelnen Erkrankten zugeschnittene personalisierte Medizin weiter gestärkt werden. Schwerpunkte werden unter anderem der weitere Ausbau innovativer Immuntherapien („CAR-T-Zellen“) und die Entwicklung neuer molekularer Therapeutika sein.
Patientenvertretung fördert Verständnis patientenorientierter Forschung
„Als WERA-Verbund mit den Standorten Würzburg, Erlangen, Regensburg und Augsburg aktiver Teil des NCT zu sein, ermögliche Prof. Dr. Nina Ditsch zufolge erstmalig die gezielte Förderung gemeinsam entwickelter translationaler Projekte mit Fokus auf Investigator initiierten Studien, also von der universitären Wissenschaft initiierte Studien ohne kommerzielles Interesse. „Darüber hinaus soll die enge Vernetzung mit Patientenvertretern verschiedenster Tumorentitäten insbesondere die frühe Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und damit das Verständnis für eine patientenorientierte Forschung fördern“, so die Leiterin des Brustzentrums am Universitätsklinikum Augsburg und Mitglied des NCT WERA-Direktoriums.
Auf hervorragende Vernetzung der CCC Allianz WERA zurückgreifen
Prof. Dr. Marianne Pavel, die ebenfalls Mitglied des NCT WERA Direktoriums und am Uniklinikum Erlangen den Schwerpunkt Endokrinologie leitet, betont die hervorragende Vernetzung der WERA-Allianz. „Die über die letzten Jahre etablierten Strukturen des CCC WERA tragen wesentlich dazu bei, die gemeinsamen Ziele von NCT und CCC zu verwirklichen.“ Denn die von der Deutschen Krebshilfe als „Onkologisches Spitzenzentrum“ ausgezeichnete „Comprehensive Cancer Center Allianz WERA“ hat sich bereits 2019 zusammengeschlossen. Schon vor der Aufnahme ins NCT wurden in der CCC Allianz WERA jedes Jahr mehr als 10.000 Patientinnen und Patienten mit allen Arten von Tumorerkrankungen neu in gemeinsame klinische Studien eingebunden.
Prof. Dr. Ralf Bargou, Direktor des Comprehensive Cancer Center (CCC Mainfranken), Sprecher des CCC WERA und Mitglied des Direktoriums NCT WERA resümiert: „Für die gemeinsame Arbeit in der WERA-Allianz ist die Unterzeichnung der Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung zur NCT-Erweiterung ein weiterer wichtiger Meilenstein. Und es ist auch eine Anerkennung für die langjährige Aufbauarbeit, die hinter diesen gemeinsamen Strukturen steht. Die kommenden Projekte werden nun nochmals weiteren Anschub geben, um die Versorgung von Menschen mit Tumorerkrankungen in der WERA-Region zu verbessern. Genau das ist das Ziel der universitären Forschung und das kennzeichnet unsere gemeinsame Arbeit.“
Hier geht es zur Pressemitteilung des Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) zur Unterzeichnung der Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung.
Ausführliche Statements von den WERA-Standorten:
Prof. Dr. Hermann Einsele, Direktor der Medizinischen Klinik und Poliklinik II am Universitätsklinikum Würzburg: „Mit der Einrichtung des NCT wird eine neue Ära für die translationale Krebsforschung am Wissenschaftsstandort Deutschland eingeläutet. Mit dem NCT WERA wird gerade im Nordbayerischen Raum mit seiner großen eher ländlichen Bevölkerung die Möglichkeit geschaffen, neueste Verfahren in der Diagnostik und Therapie von Krebserkrankung auch in der Fläche anzubieten. Für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stellt das NCT eine großartige Möglichkeit dar, die Erkenntnisse aus den Grundlagenwissenschaften und aus der präklinischen Forschung in die Klinik transferieren zu können. Die Nachwuchsforschung wird mit vielen neuen Positionen für forschungsorientierte Kolleginnen und Kollegen und neuen Karriereoptionen deutlich ausgebaut. Schließlich wird das NCT ‚protected time‘ ermöglichen, um Studienideen oder Forschungsvorhaben von jungen Ärztinnen und Ärzten in die Klinik zu bringen.
Prof. Dr. Marianne Pavel, Leiterin des Schwerpunktes Endokrinologie am Uniklinikum Erlangen: „Durch das erweiterte NCT können nun neue Therapieansätze zur Bekämpfung von Krebserkrankungen rascher und effektiver in die klinische Anwendung gebracht werden, dies auch dank der hohen Expertise im NCT Verbund. Die neuen deutschlandweiten Strukturen und Maßnahmen ermöglichen es, diese Expertise zu bündeln, und innovative klinische Forschung erstmalig in relevanten Ausmaß in Deutschland umzusetzen. Dabei können wir dankenswerterweise auf eine hervorragende Vernetzung in der CCC Allianz WERA zurückgreifen. Die über die letzten Jahre etablierten Strukturen des CCC WERA tragen wesentlich dazu bei, die gemeinsamen Ziele von NCT und CCC zu verwirklichen.
Dr. Wolfgang Herr, Direktor der Klinik für Innere Medizin III am Uniklinikum Regensburg: „Durch die NCT-Förderung erhalten alle Krebspatientinnen und -patienten, auch jene aus vorwiegend ländlichen Gebieten, an den WERA-Standorten den bestmöglichen Zugang zu modernsten onkologischen Diagnostik- und Therapieverfahren sowie zu innovativen klinischen Studien. Wir sind sehr glücklich und auch etwas stolz, dass wir nun Teil des erweiterten NCT sind.
Prof. Dr. Nina Ditsch, Leiterin des Brustzentrums am Universitätsklinikum Augsburg: „Als WERA-Verbund mit den Standorten Würzburg, Erlangen, Regensburg und Augsburg aktiver Teil des NCT zu sein, ermöglicht erstmalig die gezielte Förderung gemeinsam entwickelter translationaler Projekte mit Fokus auf Investigator initiierten Studien, also von der universitären Wissenschaft initiierte Studien ohne kommerzielles Interesse. Durch die Schaffung spezieller Vernetzungsstrukturen im Bereich von Forschung und Klinik wird der Grundstein für eine speziell auf den wissenschaftlichen Nachwuchs ausgerichtete Förderung zum Thema Krebs gelegt. Die enge Vernetzung mit Patientenvertretern verschiedenster Tumorentitäten soll insbesondere die frühe Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und damit das Verständnis für eine patientenorientierte Forschung fördern.“