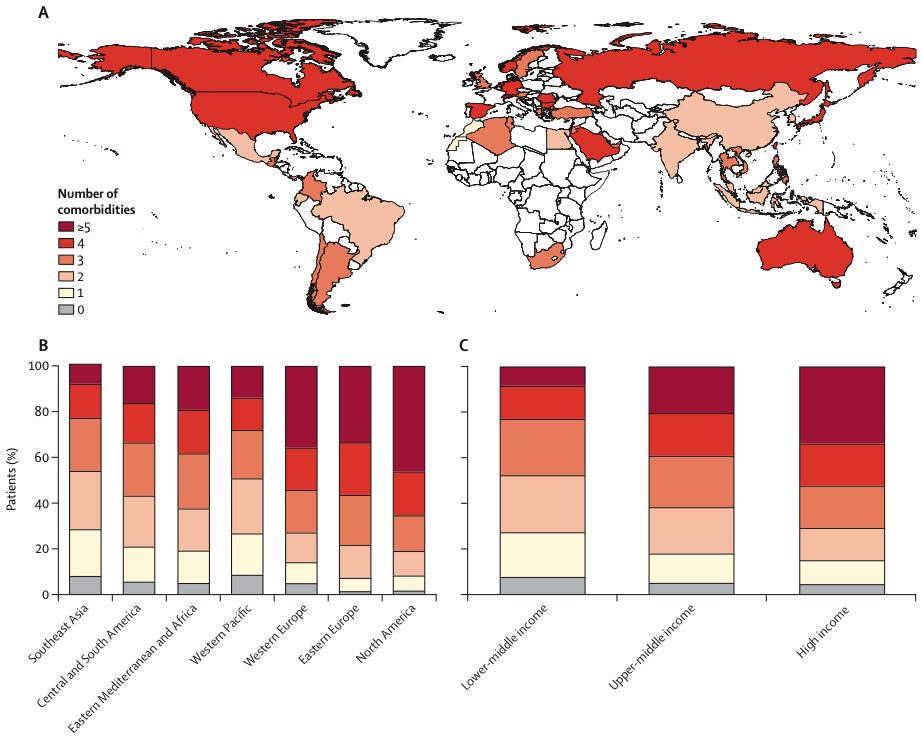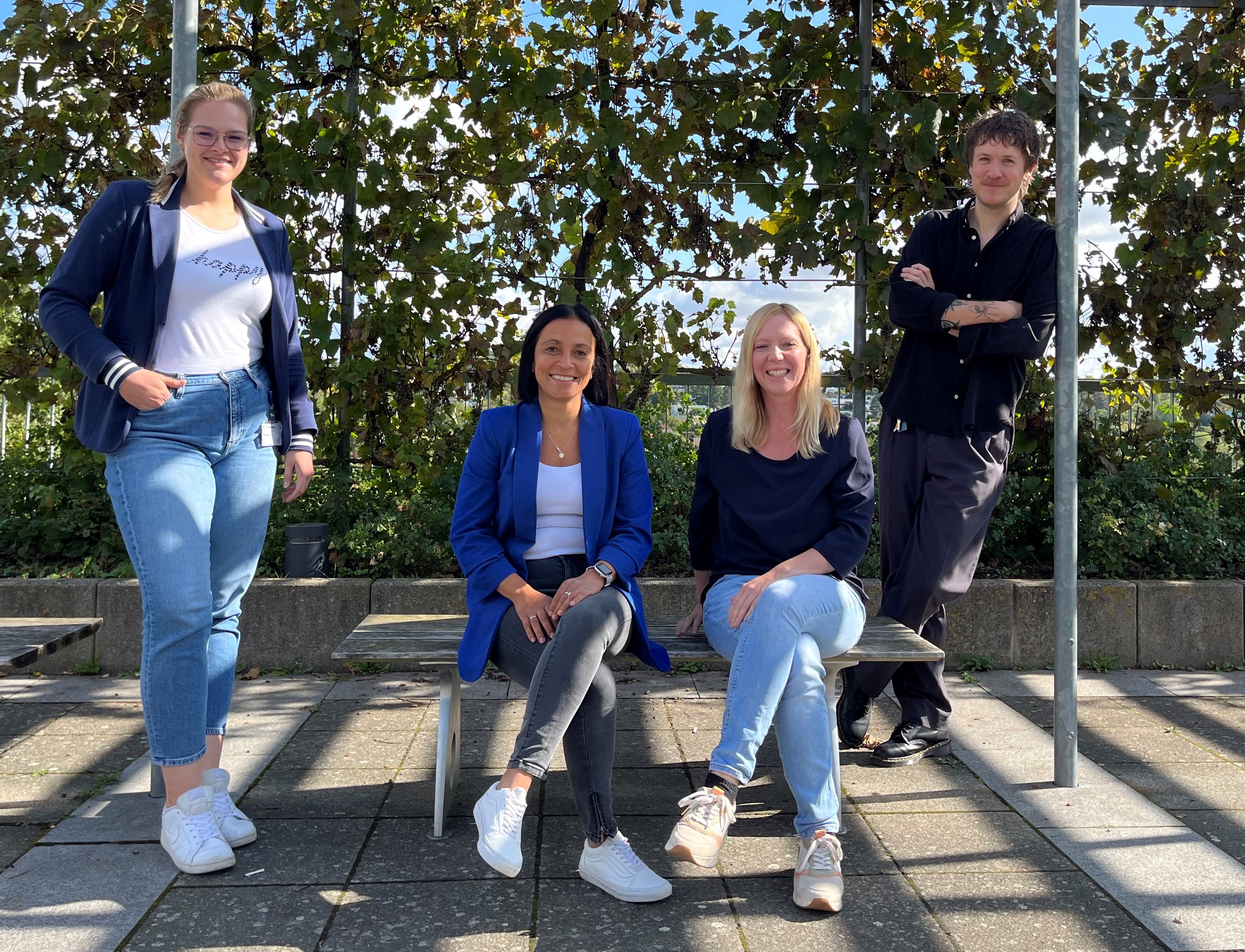Würzburg. In der psychologischen Forschung* konnte gezeigt werden, dass Gedächtnisinhalte nach dem Aufruf wieder aktiv abgespeichert werden müssen und dass dieser Prozess gestört werden kann. „Somit besteht die Möglichkeit, emotionale Gedächtnisinhalte langfristig aus dem Gedächtnis zu entfernen“, schlussfolgert Prof. Dr. Martin Herrmann, leitender Psychologe am Zentrum für Psychische Gesundheit des Universitätsklinikums Würzburg (UKW). „Im Rahmen eines von der DFG geförderten Forschungsprojekts versuchen wir nun dieses Prinzip auf die Angst vor Spinnen zu übertragen.“
Mit Transkranieller Magnetstimulation Arachnophobie löschen
Dabei werde das Angstgedächtnis zunächst kurz aktiviert, um dann mit dem Verfahren der Transkraniellen Magnetstimulation (TMS), eine nicht-invasive, nebenwirkungsarme Form der Hirnstimulation, die Wiederabspeicherung zu unterbrechen.
Personen, die unter Angst vor Spinnen leiden, sind herzlich willkommen, an unserem Forschungsprojekt teilzunehmen.
Aufwand: Ein Telefonat und drei Termine vor Ort
Der Zeitaufwand beträgt etwa vier Stunden, verteilt auf ein Telefongespräch und drei Termine vor Ort in einem Gesamtzeitraum von etwa vier Monaten. Alle Termine werden in persönlicher Absprache mit den Studienteilnehmenden vereinbart. Die Teilnahme an der Studie ist kostenlos und anonym.
Bei Interesse melden Sie sich gerne unverbindlich bei unserem Studienteam per Mail an: Spider_VR@ukw.de
Über die Spinnenphobie
Die Angst vor Spinnen zählt zu den häufigsten spezifischen Phobien. Die irrationale Angst vor den achtbeinigen Tieren, die mit Schweißausbrüchen, Herzrasen, Zittern oder sogar Atemnot einhergehen kann, lässt sich trotz des Wissens, dass eigentlich keine Gefahr droht, nicht vertreiben. Allein das Wort Spinne kann Stressreaktionen auslösen. Mehrheitlich sind Frauen von einer Spinnenphobie betroffen, die im Fachjargon als Arachnophobie bezeichnet wird. Im Zentrum für Psychische Gesundheit am UKW werden symptomorientierte Therapien entwickelt, die mit innovativen Methoden die bewährten Expositionstherapien bei Angst vor Spinnen, aber auch bei Höhenangst, erweitern und ihre Wirksamkeit verbessern.
Spider VR - Expositionstherapie in virtueller Realität
In einem vorhergehenden Forschungsprojekt namens Spider VR hat das Uniklinikum Würzburg gemeinsam mit dem Uniklinikum Münster eine Expositionstherapie in virtueller Realität (VR) untersucht. Insgesamt wurden 174 Personen mit Angst vor Spinnen in einer virtuellen Welt mit den angstauslösenden Tieren konfrontiert. Ziel der Studie war es, die grundsätzlich aussagekräftigen Charaktereigenschaften, Umstände oder Merkmale einer Person – die Prädiktoren – für eine erfolgreiche Expositionstherapie aus der Vielzahl möglicher Variablen herauszuarbeiten. Betroffene, die aufgrund der Erkenntnisse auf die alleinige Standardtherapie vermutlich nicht optimal ansprechen, könnten so zukünftig von Beginn ihrer Therapie an ergänzende Therapieangebote erhalten., haben sich zahlreiche Publikationen ergeben. Die wichtigsten Ergebnisse des im Rahmen des Sonderforschungsbereich Furcht, Angst, Angsterkrankungen (SFB Transregio 58) geförderten Projekts wurden im Journal of Anxiety Disorders veröffentlicht.
*Das DFG-Projekt baut auf zwei Studien auf. In den Fachzeitschriften Current Biology und iScience beschrieben Sara Borgomaneri et al und Sizhen Su et al, wie eine gezielte Theta-Burst-Stimulation die Rekonsolidierung des Angstgedächtnisses stört und die Rückkehr der Angst verhindert.
Wuerzburg Web Week 2023 - VR in der Psychotherapie
Am Montag, 20. November von 16:00 bis 17:00 Uhr, demonstriert Martin Herrmann in einer Online-Veranstaltung, wie VR zunehmend als effektives Therapiewerkzeug in der Psychotherapie zur Behandlung von Angsterkrankungen eingesetzt wird. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Zoom-Link ist hier hinterlegt.