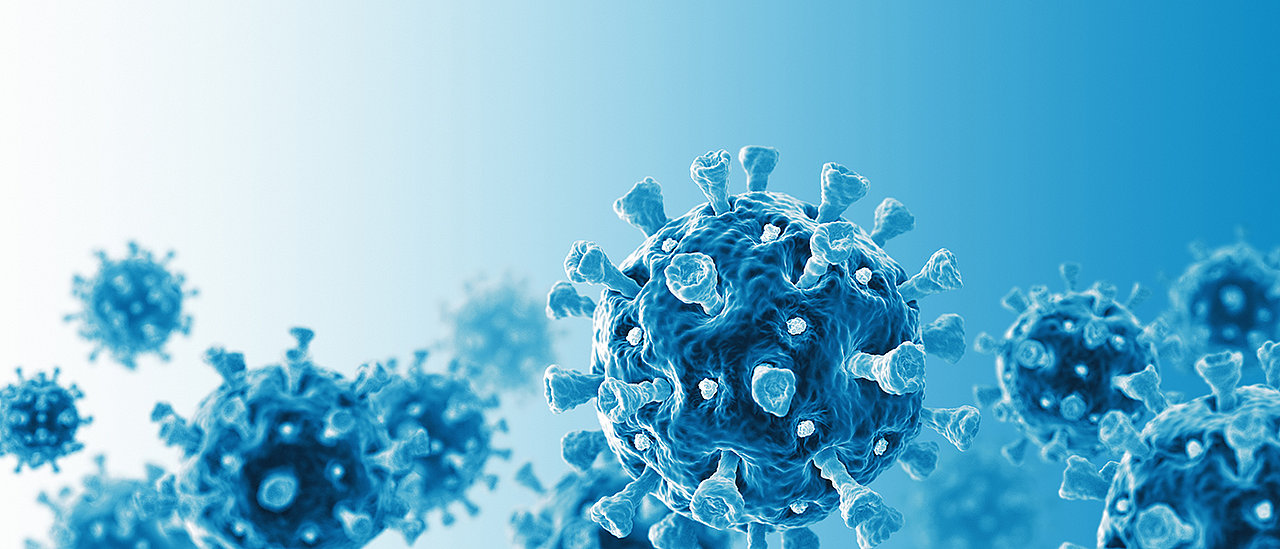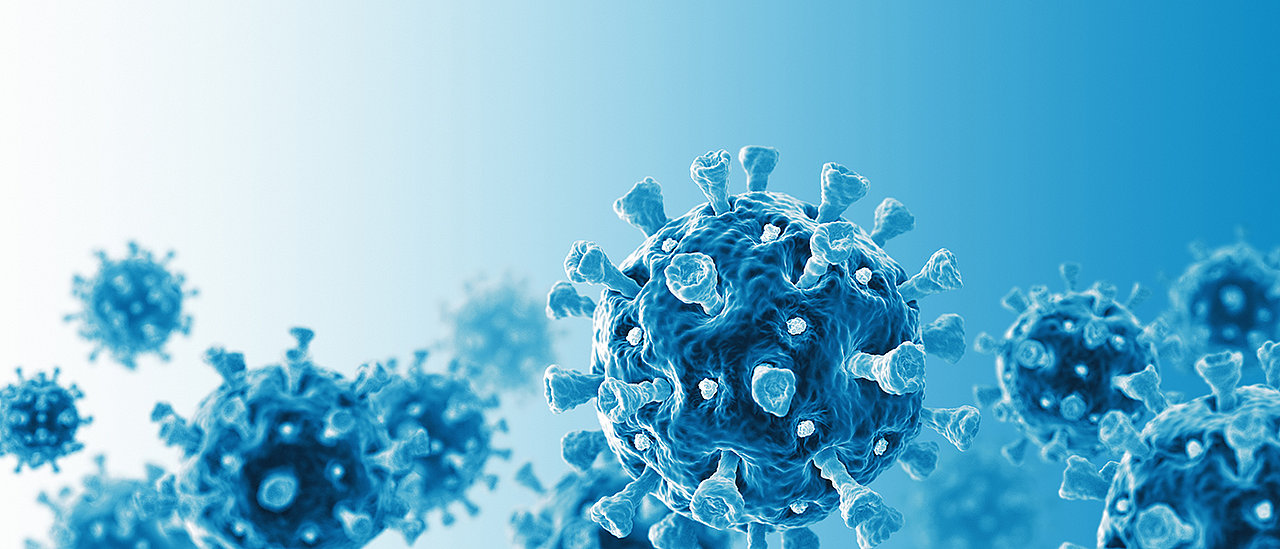
Nur zur Erinnerung: 2020 – zu Beginn der Coronapandemie – blickte ganz Deutschland wie gebannt auf den sogenannten R-Wert, der täglich neu in den Medien veröffentlicht wurde. Lag er über 1, war klar: Die Pandemie würde sich weiter ausbreiten. Ein Wert unter 1 hingegen versprach einen Rückgang der Infektionszahlen. Werte von über 2, wie sie das Robert-Koch-Institut in dieser Zeit berechnete, verhießen nichts Gutes: Sie standen für eine exponentielle Verbreitung von SARS-CoV-2.
Eine jetzt in der Fachzeitschrift Scientific Reports veröffentlichte Studie kommt allerdings zu dem Schluss: In Wirklichkeit war der R-Wert deutlich niedriger als bisher angenommen. Verantwortlich für diese Berechnungen sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Institut für Virologie und Immunbiologie und vom Lehrstuhl für Bioinformatik der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU). Hauptautoren sind der Virologe Carsten Scheller und der Bioinformatiker Thomas Dandekar.
R0-Wert: Grundlage vieler Vorhersagen
„Die sogenannte Basisreplikationszahl R0 eines Virus beschreibt die durchschnittliche Anzahl von Personen, die ein Infizierter ansteckt in einer Bevölkerung, die bislang noch keinen Kontakt mit dem Virus gehabt hat“, beschreibt Carsten Scheller den Hintergrund der Studie.
Dementsprechend ist R0 ein Schlüsselfaktor, wenn es darum geht, Vorhersagen über die Ausbreitung eines Virus zu treffen oder um abzuschätzen, wie viele Menschen sich infizieren müssen, um das Ziel der Herdenimmunität zu erreichen. „Außerdem lässt sich anhand des R0-Werts vorhersagen, ob ein Atemwegsvirus in gemäßigten Klimazonen eher ein saisonales Infektionsmuster entwickelt, wie beispielsweise Grippeviren, oder ob eine kontinuierliche Übertragung während des ganzen Jahres erfolgt“, so der Virologe.
Schätzungen schwanken stark
Im Fall von SARS-CoV-2 schwankten die ermittelten R0-Werte deutlich. Eine erste Schätzung auf der Grundlage der Daten von 425 bestätigten Fällen in Wuhan ergab einen Wert von 2,26. Spätere Berechnungen hatten 5,77 zum Ergebnis. Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation bewegten sich zwischen 1,95 und 6,49. Das deutsche Robert-Koch-Institut geht auf der Grundlage systematischer Übersichten von einem R-Wert im Bereich zwischen 2,8 und 3,89 aus.
„All diesen Schätzungen und Berechnungen ist gemeinsam, dass sie auf der Inzidenz von SARS-CoV-2-Infektionen beruhen, die mit einem PCR-Test nachgewiesen wurden“, sagt Carsten Scheller. Das Problem dabei: Diese Schätzungen sind nicht nur von den Merkmalen der untersuchten Population abhängig, sondern auch von den Teststrategien sowie von der steigenden Zahl verfügbarer und durchgeführter Tests in den ersten Wochen der Pandemie – zumindest dann, wenn keine mathematischen Korrekturen für diesen Anstieg vorgenommen werden.
Übersterblichkeit als Grundlage
Um seine Berechnungen von solch unsicheren Einflussfaktoren zu befreien, hat sich das Team der Universität Würzburg dafür entschieden, eine andere Datengrundlage zu wählen: den Anstieg der Sterblichkeit im Vergleich zu Vor-Corona-Jahren, die so genannte Übersterblichkeit. „Da die SARS-CoV-2-Infektion in vielen Ländern zu einer erhöhten Übersterblichkeit geführt hat, können diese Daten als Ersatzmarker für die Verbreitung des Coronavirus verwendet werden. Und da die Übersterblichkeit unabhängig von der Anzahl oder Strategie der durchgeführten Tests ist, liefert sie ein repräsentatives Bild für die Ausbreitung der Infektionen in der Allgemeinbevölkerung“, so der Virologe.
Dabei musste das Team allerdings einen wichtigen Aspekt berücksichtigen: die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt für die Erhebung der Daten. So hatte Deutschland frühzeitig Maßnahmen ergriffen, um die SARS-CoV-2-Epidemie einzudämmen – angefangen vom Verbot von Massenveranstaltungen (9. März) über Schulschließungen (16. März) bis zum kompletten Lockdown (23. März). All diese Einschränkungen sowie die breite Medienberichterstattung könnten nach Ansicht der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen Einfluss auf die Verbreitung des Coronavirus gehabt haben.
„Aus diesem Grund haben wir für unsere Berechnungen nur Sterbefälle bis einschließlich 11. April 2020 verwendet. Da sich die Infektionen dieser Sterbefälle bereits im Mittel 25 Tage vor dem Tod ereignet haben, konnten die beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen keinen Einfluss auf den berechneten Wert von R0 gehabt haben“, erklärt der Bioinformatiker Thomas Dandekar.
Ausweitung der Testkapazitäten führt zu Überschätzung
Auf dieser Basis kommt das Team zu folgendem Ergebnis: „Wir ermittelten einen R0-Wert von 1,34 für Infektionen im März 2020, was einem saisonalen Bereich von 1,68 im Januar und einem Minimum von 1,01 im Juli entspricht.“ Diese eher niedrige Spanne von R0-Werten stimme viel besser mit den Beobachtungen des Pandemieverlaufs überein als viele frühere und viel höhere Schätzungen, so die an der Studie Beteiligten. Hauptursachen für diese Überschätzung ist ihrer Ansicht nach die massive Ausweitung der Testkapazitäten in der Frühphase der Pandemie in Verbindung mit Änderungen der Teststrategie.
Dieser relativ niedrige R0-Wert hat nach Ansicht der Forschungsgruppe wesentlich zu einem Rückgang der Infektionszahlen im Frühjahr 2020 beigetragen. Die Effekte des Lockdowns auf die Ausbreitung des Virus seien deshalb möglicherweise nicht so hoch gewesen wie es scheinen mag. Bei einer vergleichbaren Entwicklung müsste deshalb eine Kosten-Nutzen-Abwägung von Lockdown-Maßnahmen anders ausfallen als in der Vergangenheit.
Neue Virusvarianten können andere R-Werte besitzen
Welche Bedeutung haben diese Ergebnisse jetzt noch vor dem Hintergrund, dass längst andere SARS-CoV-2-Varianten durchs Land ziehen? „Die neuen, meist ansteckenderen Varianten sollten durchaus in einer vom Virus unberührten menschlichen Population einen anderen R0-Wert besitzen als die Ursprungs-Variante. Das lässt sich allerdings nie mehr berechnen, weil die Bevölkerung sehr viel Immunität durch bereits durchgemachte Infektionen und auch durch Impfungen aufgebaut hat“, erklärt Carsten Scheller.
Der niedrigere R0-Wert der Original-Variante ermögliche nun aber eine bessere Sicht auf die einzelnen Infektionswellen. Schließlich bedeute ein niedriger R-Wert auch, dass eine Herdenimmunität bereits früh erreicht wird. Dann hat das Virus keine Möglichkeit, sich weiter zu verbreiten, mit der Konsequenz, dass sich ständig neue Varianten bilden. „Die einzelnen Wellen, hervorgerufen durch sogenannte Immune-escape-Varianten, sind also etwas ganz normales“, sagt der Virologe. Sind etwa ein Drittel der Bevölkerung infiziert, brechen diese Wellen der Original-Variante von alleine wieder ab, was für die Planung von Gegenmaßnahmen wichtig zu wissen sei.
Einschränkungen müssen berücksichtigt werden
Allerdings sind sich die Autoren der jetzt veröffentlichten Studie darüber bewusst, dass auch ihr Modell gewissen Einschränkungen unterliegt. So könnten beispielsweise pandemiebedingte medizinische Engpässe zu einem Anstieg der Übersterblichkeit führen, der unabhängig von einem direkten Effekt der Virusinfektionen ist. Eine solche Verzerrung würde zu einer Überschätzung des R-Werts führen.
Zusätzlich beziehen sich Aussagen zu einer Übersterblichkeit immer auf einen bestimmten Referenzzeitraum, wie beispielsweise das Vorjahr oder – wie im Fall dieser Studie – auf die vorausgegangenen vier Jahre. Ein Anstieg oder Rückgang ist dementsprechend immer abhängig von der Entwicklung der Sterbeziffern in den Jahren davor.
Und zuletzt sei es Voraussetzung für die Ermittlung richtiger Werte, dass sich der Anteil besonders gefährdeter Gruppen an der gesamten Infektionsinzidenz im Analysezeitraum nicht wesentlich verändert. Zudem werden mit der Zeit die stärker ansteckenden Virusvarianten bevorzugt weitergegeben und dominieren schließlich das Infektionsgeschehen.
Ein wertvolles Instrument für künftige Pandemien
Würden alle diese Faktoren berücksichtigt, sind die Autorinnen und Autoren der Studie davon überzeugt, dass sich die Übersterblichkeit bei künftigen Pandemien als wertvolles Instrument anbietet, um zuverlässige Werte für die Ausbreitungsrate eines neu auftretenden Erregers in einer Bevölkerung zu ermitteln. Politische Entscheidungen könnten aus dieser Basis besser an die Realität angepasst werden.
Originalpublikation
Estimation of R0 for the spread of SARS-CoV-2 in Germany from excess mortality. Juan Pablo Prada, Luca Estelle Maag, Laura Siegmund, Elena Bencurova, Liang Chunguang, Eleni Koutsilieri, Thomas Dandekar & Carsten Scheller. Scientific Reports, 14. October 2022, https://doi.org/10.1038/s41598-022-22101-7
Kontakt
Prof. Dr. Carsten Scheller, Institut für Virologie und Immunbiologie, T: +49 931 31-81563, scheller@vim.uni-wuerzburg.de
Prof. Dr. Thomas Dandekar, Lehrstuhl für Bioinformatik, T: +49 931 31-84551, dandekar@biozentrum.uni-wuerzburg.de
Pressemitteilung der Universität Würzburg vom 19.10.2022