
Wie kamen Sie zur Biomedizin?
Biologie fand ich schon immer spannend. Nach dem Abitur wusste ich allerdings nicht, ob ich Medizin oder Biomedizin studieren sollte. Also schrieb ich mich für beide Fächer ein. Da beide Fächer einen NC hatten, hoffte ich, wenigstens eine Zusage zu erhalten. Doch dann hatte ich tatsächlich zwei Zusagen und musste mich entscheiden. Ehrlich gesagt konnte ich direkt nach der Schule nicht richtig einschätzen, was das eine oder andere Fach im echten Leben bedeutet. Daher ließ ich meinen Bauch entscheiden. Und der entschied sich gegen eine spätere Tätigkeit als Ärztin und für die Biomedizin.
Haben Sie die Entscheidung jemals bereut?
Nein, nie. Als Ärztin wäre ich vielleicht etwas flexibler und nicht so festgefahren auf die Forschung. Wenn die Wissenschaft mir nicht gelegen hätte, wäre ich mit Biomedizin definitiv eingeschränkter. Aber ich fand es schon immer spannend, Zusammenhänge zu ergründen und zu verstehen. Das ist auch heute noch mein Antrieb: ein tieferes mechanistisches Verständnis von kardiovaskulärer Gesundheit und Krankheit zu erlangen und damit zu sicheren, wirksameren und klinisch relevanten Therapieansätzen beizutragen. Durch die Untersuchung grundlegender biologischer Prozesse möchte ich dazu beitragen, die Lücke zwischen Grundlagenforschung und klinischer Anwendung zu schließen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Verständnis der grundlegenden Prinzipien von Gesundheit und Krankheit entscheidend für echten medizinischen Fortschritt ist.
Sie arbeiten in der Experimentellen Biomedizin I, dem Herzen der Würzburg Platelet Group. Wie sind Sie dazu gekommen?
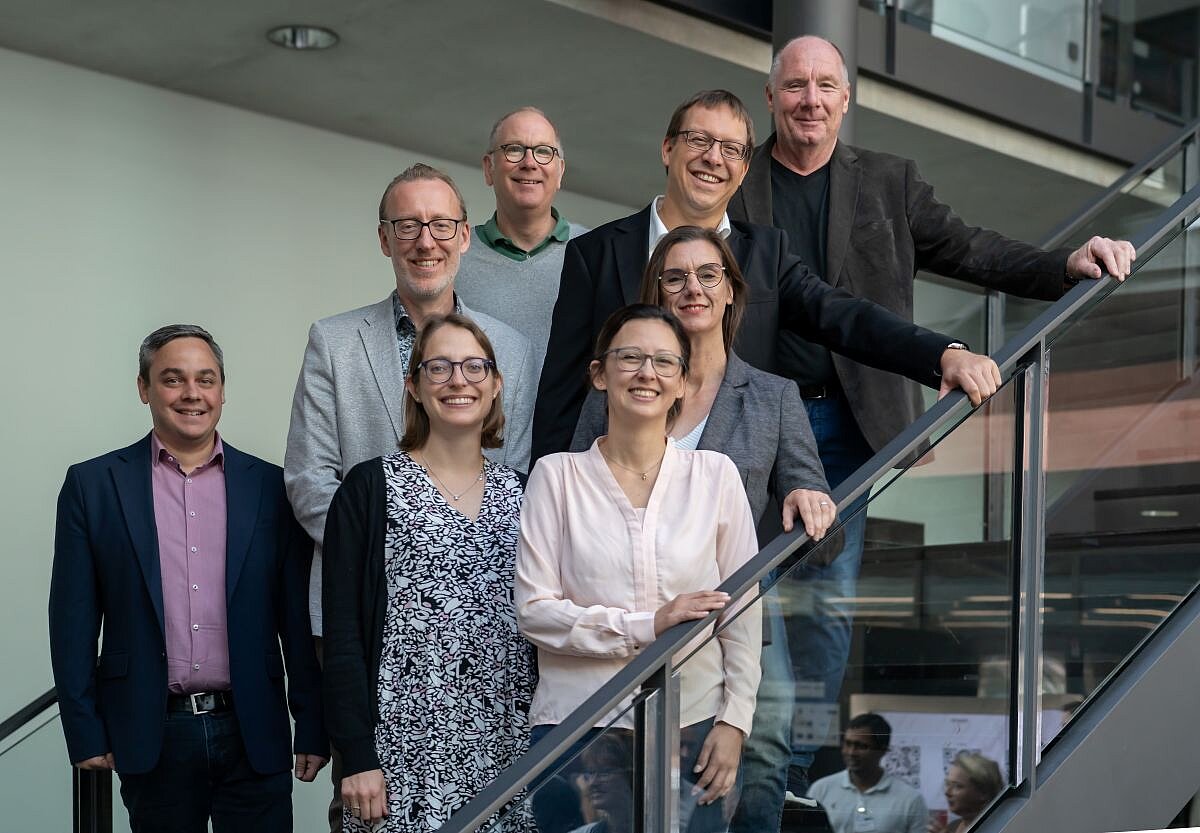
Einerseits hatte ich im Studium nie mit Tieren gearbeitet. Diese Erfahrung erschien mir jedoch wichtig für meine berufliche Zukunft. Daher wollte ich im Rahmen meiner Masterarbeit herausfinden, ob mir die Arbeit mit Mäusen liegt. Wenn es mir nicht gefallen hätte, wäre die Arbeit nach einer überschaubaren Zeit vorbei gewesen. Andererseits ist das Labor von Bernhard Nieswandt in der Experimentellen Biomedizin I sehr angesehen und ich wollte schauen, ob ich eine Chance habe, dort aufgenommen zu werden. Die hatte ich und habe sie genutzt.
Die Würzburg Platelet Group widmet sich der Grundlagen-, translationalen und klinischen Forschung auf dem Gebiet der Thrombozyten- und Megakaryozytenbiologie in Gesundheit und Krankheit. Was ist das Besondere an Blutplättchen und ihren Mutterzellen?

Der Prozess der Hämostase ist lebenswichtig, da er Blutungen stillt und Wunden schließt. Bei der Blutstillung heften sich Thrombozyten an die Wundränder und bilden einen Pfropf, der die Verletzung zunächst abdichtet. Bei der Blutgerinnung, auch Koagulation genannt, werden lange Fasern aus Fibrin gebildet. Diese dichten gemeinsam mit den Blutplättchen die Wunde fest ab. Wird jedoch zu viel Fibrin gebildet, beispielsweise bei chronischen Wunden, oder schießt die Thrombozytenaktivierung über, kann es zu Gefäßverschlüssen, sogenannten Thrombosen, kommen. Löst sich der Thrombus, wandert im Blutkreislauf weiter und verstopft ein anderes Gefäß, spricht man von einer Embolie. So kann ein Thrombus, der ein Gefäß im Gehirn blockiert, einen Schlaganfall auslösen und ein Thrombus, der den Blutfluss in den Herzkranzgefäßen stört, einen Herzinfarkt auslösen.
Megakaryozyten sind die größten Zellen im Knochenmark. Sie schnüren Zellfragemente ab, das sind die Thromboyzten, auch Blutplättchen genannt. Sie sind die kleinsten zellulären Bestandteile des Blutes und besitzen keinen Zellkern. Das macht sie sehr empfindlich. Sie können nicht eingefroren werden, benötigen konstante 37 Grad und verlieren schnell an Qualität. Das heißt, wir benötigen kurze Transportwege und müssen unsere Experimente immer binnen zwei bis drei Stunden abgeschlossen haben. Und dann eröffnen sich immer wieder neue Möglichkeiten. Früher dachte man, Blutplättchen seien nur wichtig für die Blutstillung und Blutgerinnung, die sogenannte Hämostase. Doch sie können viel mehr bewirken und verursachen.
Blutplättchen helfen also nicht nur bei der Blutgerinnung, sondern sind auch zentrale Treiber von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Viele Therapien erhöhen jedoch das Blutungsrisiko. Wo setzt Ihre Forschung hier an?
Ich untersuche Thrombozyten und das Zusammenspiel ihrer Rezeptoren unter physiologischen sowie krankhaften Bedingungen. Das Ziel besteht darin, neue Therapeutika zu entwickeln, die genau an den Thrombozytenrezeptoren ansetzen und deren Funktion so modulieren, dass Thrombosen verhindert werden, ohne die Blutstillung zu beeinträchtigen.
Einen vielversprechenden therapeutischen Ansatz haben Sie mit dem Glykoprotein V, kurz GPV, entdeckt.
GPV befindet sich auf der Oberfläche von Thrombozyten und wird während der Blutgerinnung vom Enzym Thrombin freigesetzt. Dieses abgeschnittene, lösliche GPV bleibt an Thrombin gebunden und verändert dessen Aktivität, sodass weniger Fibrin gebildet wird. In verschiedenen Versuchen mit experimentellen Thrombosemodellen konnten wir mit diesem Ansatz (Zugabe von löslichem GPV) die Bildung von Thromben, die Gefäße verschließen, verhindern.
Auf der anderen Seite kann ein Eingreifen in diesen Mechanismus bei Menschen mit Blutungsproblemen die Blutstillung verbessern.
Wir haben einen Antikörper gegen GPV entwickelt. Dieser blockiert das Abschneiden von GPV von der Thrombozytenoberfläche. Dadurch wird die Thrombin-Aktivität und die Fibrinbildung erhöht und wir konnten zeigen, dass dies die Blutstillung in Fällen mit gestörter Hämostase verbessern. Wir sind überzeugt, dass diese anti-GPV-Behandlung ein großes klinisches Potenzial hat. Derzeit führen wir Untersuchungen in einem humanisierten Mausmodell durch.

Sie leiten auch im neuen Graduiertenkolleg „Thrombo-Inflammation“ ein Projekt. Der Begriff wurde in Würzburg geprägt. Was steckt dahinter?
Inzwischen wissen wir, dass Thrombozyten an vielen Entzündungsreaktionen beteiligt sind und eine Rolle bei einer stetig wachsenden Zahl von Krankheitsgeschehen wie Schlaganfall, Blutvergiftung (Sepsis) oder akutem Lungenversagen (ARDS) spielen. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gab es sogar einen regelrechten Hype um Blutplättchen, da sie für viele schwerwiegende Komplikationen der Krankheit verantwortlich sind. Auch ihr Zusammenspiel mit Immunzellen rückt immer mehr ins Forschungsfeld. Thrombo-Inflammation verdeutlicht diese Prozesse: eine durch Thrombozyten getriebene Entzündungsreaktion. Durch die Weiterentwicklung der Mikroskopietechnik entdecken wir zudem immer wieder ganz neue Möglichkeiten. (Details zum Projekt P02 im GRK 3190)
Demnächst bauen Sie auch ihre eigene Forschungsgruppe mit Fördergeldern der Deutschen Forschungsgemeinschaft auf. Welches Projekt verfolgen Sie hier?
Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der Chemie möchte ich sogenannte photoschaltbare Inhibitoren untersuchen. Das sind Wirkstoffe, deren hemmende Wirkung sich mit Licht ein- und ausschalten lässt. Wenn jemand beispielsweise dauerhaft Antikoagulanzien nehmen muss – das sind Medikamente, die verhindern, dass das Blut zu schnell oder unkontrolliert gerinnt und verklumpt –, hätte diese Person bei einer spontanen Operation ein hohes Blutungsrisiko. Wir versuchen, hier mithilfe von Licht, also Photoaktivität, Inhibitoren ein- bzw. kurzfristig auszuschalten, um das Risiko einer Blutung zu reduzieren.
Wie sieht denn Ihr Arbeitsalltag aus?
Früher habe ich viel mehr im Tierstall und im Labor gearbeitet. Ich habe beispielsweise Mäuse operiert und viel mikroskopiert. Heute verbringe ich immer mehr Zeit am Schreibtisch, werte Daten aus und schreibe Projekt- sowie Tierversuchsanträge. Ein wichtiger Teil meiner Arbeit ist außerdem die Betreuung des Personals und der Studierenden. Ich führe sie beispielsweise in neue Techniken ein und sorge dafür, dass im Labor alles reibungslos läuft. Ein wichtiger Teil meiner Arbeit ist natürlich auch die Lehre mitsamt den Vorlesungen.
Was bedeutet Ihre Forschung für Sie?
Für mich ist die kardiovaskuläre Forschung nicht nur ein wissenschaftliches Unterfangen, sondern auch eine Verantwortung: Ich möchte Wissen schaffen, das das Potenzial hat, die Patientenversorgung und damit die Lebensqualität zu verbessern. Forschung ist nicht nur mein Beruf, sondern auch meine Leidenschaft. Sie ermöglicht es mir, kontinuierlich zu lernen, mich weiterzuentwickeln und einen sinnvollen Beitrag zu leisten.
Im Februar 2026 wurden Sie für Ihre translationale Forschung in den Bereichen Hämostase, Thrombose und Thrombo-Inflammation mit dem Frank-Misselwitz-Memorial-Award gewürdigt. Wie fühlt sich das an?
Der Erhalt dieses Preises ist eine außergewöhnliche Ehre und eine starke Anerkennung dafür, dass meine Forschung nicht nur für mich persönlich, sondern auch über mein unmittelbares akademisches Umfeld hinaus bedeutsam ist. Zu wissen, dass meine Arbeit bei anderen Personen Resonanz findet, ist unglaublich ermutigend. Diese Auszeichnung motiviert mich sehr, meine Forschung weiterhin mit Hingabe, Neugier und Ehrgeiz fortzusetzen.
→ Pressemeldung zur Auszeichnung

Ihre Forschung muss im Moment pausieren. Sie konnten den Preis nicht persönlich entgegennehmen, da die Geburt Ihres zweiten Kindes bevorsteht. Sie haben bereits einen kleinen Sohn. Wie vereinbaren Sie Beruf und Familie?
Es wurde tatsächlich viel dafür getan, dass ich Beruf und Familie vereinbaren kann. So konnte ich von der Uni zum UKW wechseln und meinen Sohn in der UKW-Krippe „Grombühlzwerge” direkt in der Nähe des Campus anmelden. Das gesamte Team gibt mir zudem Rückendeckung, wenn ich mal kurzfristig ausfalle. Der Zusammenhalt basiert auf großem Vertrauen. Außerdem hat mein Mann nach meinen zehn Monaten Elternzeit ebenfalls Elternzeit genommen und unseren Sohn später in der Krippe eingewöhnt. Für den Abnabelungsprozess war das sehr gut. Wie wir das bei unserem zweiten Kind machen werden, wissen wir noch gar nicht. Mein Mann ist beruflich bedingt viel unterwegs und meist nur am Wochenende zu Hause. Doch zum Glück habe ich noch meine Eltern zur Unterstützung hier.
Gab es Überlegungen, mit Ihrem Mann den Standort zu wechseln?
Als mein Mann beruflich länger im Ausland tätig war, verband ich diese Zeit mit einem Forschungsaufenthalt. Ein Wechsel nach München stand auch einmal zur Diskussion. Aber Würzburg ist einfach meine Heimat, die Basis und auch für meine Forschung „the place to be“. Neben der Kinderbetreuung am UKW bietet die Experimentelle Biomedizin hier ein ideales Forschungsumfeld mit guten Fragestellungen, eine exzellente Zusammenarbeit mit tollen Kolleginnen und Kollegen, die über herausragende Expertisen verfügen, Zugang zu Patientenmaterial mit kurzen Wegen, die für die sensiblen Blutplättchen extrem wichtig sind, eine weltweit einmalige Ausstattung und eine breite Methodenvielfalt, die wir selbst generiert und etabliert haben.
Haben Sie schon einmal schlechte Erfahrungen aufgrund ihres Geschlechts gemacht?
Ich war immer auf der glücklichen Seite und habe keine Diskriminierung erfahren. Vielleicht war es eher umgekehrt: Ich befürchtete, als Quotenfrau bestimmte Projekte erhalten zu haben. Wer will schon eine Quotenfrau sein? Wenn ich weiß, dass es gleichzeitig einen genauso qualifizierten Mann gibt, der aber vielleicht schlechtere Chancen hat, weil er ein Mann ist, dann trifft das nicht den Kern der Sache.
Die Biomedizin ist wie die Medizin ein eher weiblicher Studiengang. Viele Frauen gehen aber irgendwann auf der Karriereleiter verloren. Woran liegt das?
Es ist tatsächlich nicht einfach, Familie und Forschung unter einen Hut zu bringen – obwohl es viele Bemühungen und Gleichstellungsmaßnahmen gibt.
Allein die strengen Vorschriften während der Schwangerschaft legen einem Steine in den Weg. Werdende Mütter dürfen nicht mehr viel machen. Am Anfang fällt es mit einem Baby in den ersten Monaten ebenfalls schwer, Schritt zu halten und konsequent zu arbeiten. Diese Zeiten fehlen einem später auf der Karriereleiter, da ich in der Zeit nicht im selben Umfang Daten generieren, meine Arbeitsgruppe weiterentwickeln und publizieren kann.

Und für viele Mütter ist es wahrscheinlich ein Problem, nach der Elternzeit wieder voll einzusteigen.
Es ist nicht nur ein Problem, voll einzusteigen, sondern überhaupt einzusteigen. Wir haben ja nur ein Leben. Vor den Kindern habe ich Forschung nicht nur als Vollzeitarbeit, sondern als Vollzeitleben betrieben. Als arbeitende Mutter lebe ich nun jedoch in zwei völlig getrennten Welten. Ich arbeite morgens im Labor und Büro und am Nachmittag wartet mein Kind auf mich. Forschung hört aber nicht mit dem Schließen der Büro- oder Labortüre auf, oft warten abends und am Wochenende E-Mails, Anträge und Vorlesungen, die vorbereitet werden wollen. Beidem gerecht zu werden ist schon eine große Herausforderung. Da ist auch ein verlässliches Kinderbetreuungsangebot wie bei den „Grombühlzwergen“ wichtig, um die Kinder tagsüber gut betreut zu wissen.
Was raten Sie dem Nachwuchs bei der beruflichen Orientierung?
Ich empfehle auf jeden Fall, zielgerichtete Praktika zu absolvieren. Wer noch nicht weiß, in welche Richtung er oder sie gehen möchte, sollte nach dem Ausschlussprinzip vorgehen. So erfährt man, was einem nicht liegt oder was man nicht möchte.
Warum hat die Wissenschaft ein Nachwuchsproblem?
Viele können mit dem Druck von außen nicht umgehen bzw. machen sich oft selbst Druck. Bei meiner Promotion habe ich mir auch sehr viel Druck gemacht. Inzwischen habe ich jedoch gelernt, damit umzugehen. Allerdings beobachte ich immer häufiger, dass die jüngere Generation nicht mehr so leidenschaftlich ist und weniger für die Arbeit brennt. Viele arbeiten nur das ab, was ihnen vorgegeben wird. Dabei ist es doch gerade die intrinsische Motivation und der Wunsch, sich weiterzuentwickeln, die einen Forscher oder eine Forscherin ausmachen. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber sie werden immer schwieriger zu finden.
Zum Schluss, die Frage nach den drei Wünschen. Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, welche wären das?
Tatsächlich gehöre ich zu den Menschen, die wunschlos glücklich sind und einfach schauen, was passiert. Ziele habe ich natürlich: die Habilitation, die ich weiter vorantreiben müsste sowie der erfolgreiche Aufbau meiner eigenen Arbeitsgruppe. Und dabei perspektivisch eine dauerhaft tragfähige Vereinbarkeit von Forschung und Familie. Aber ist das wirklich ein Wunsch-Wunsch? Der wäre, dass die Familie irgendwann wieder an einem Ort ist.

