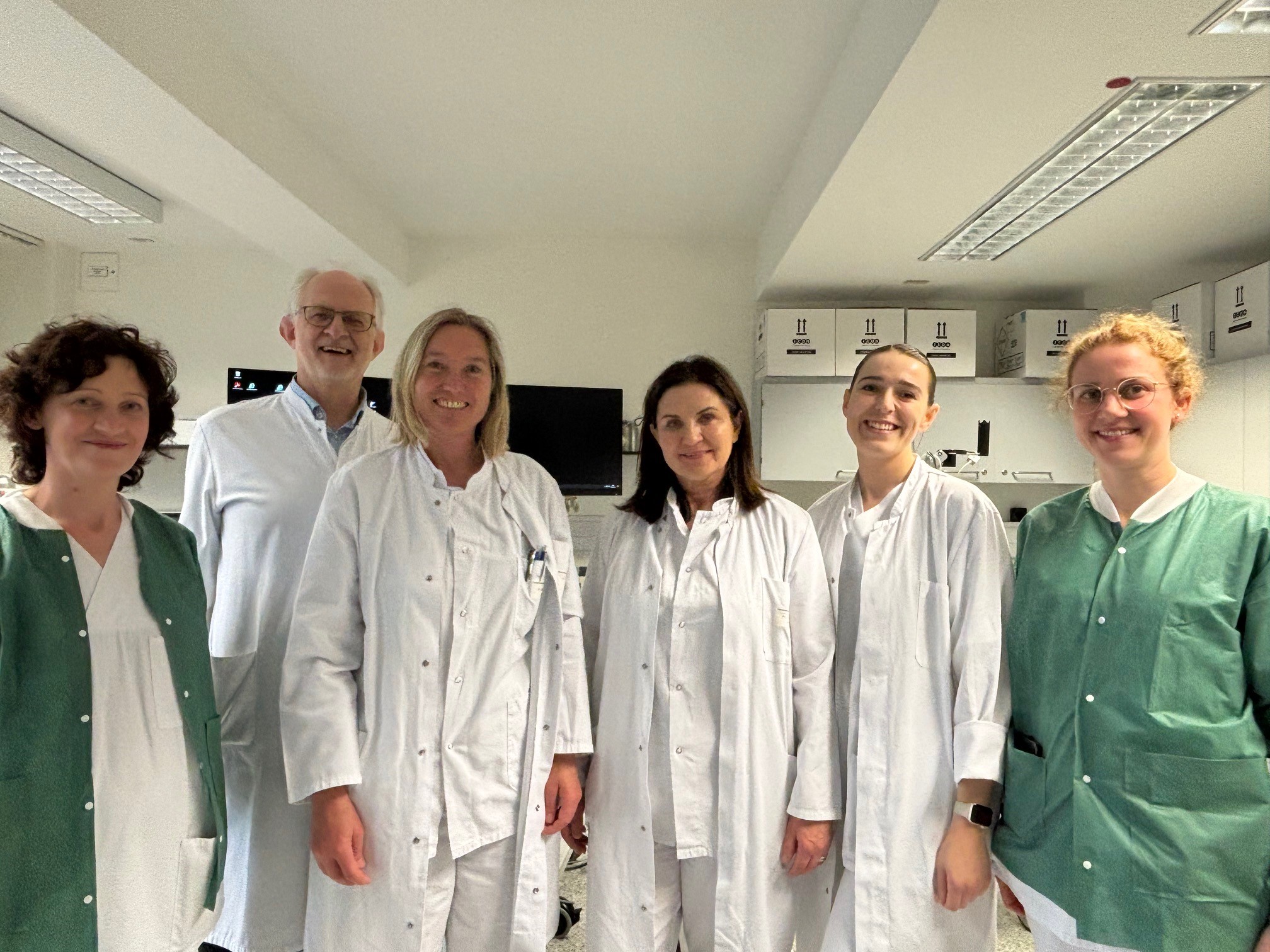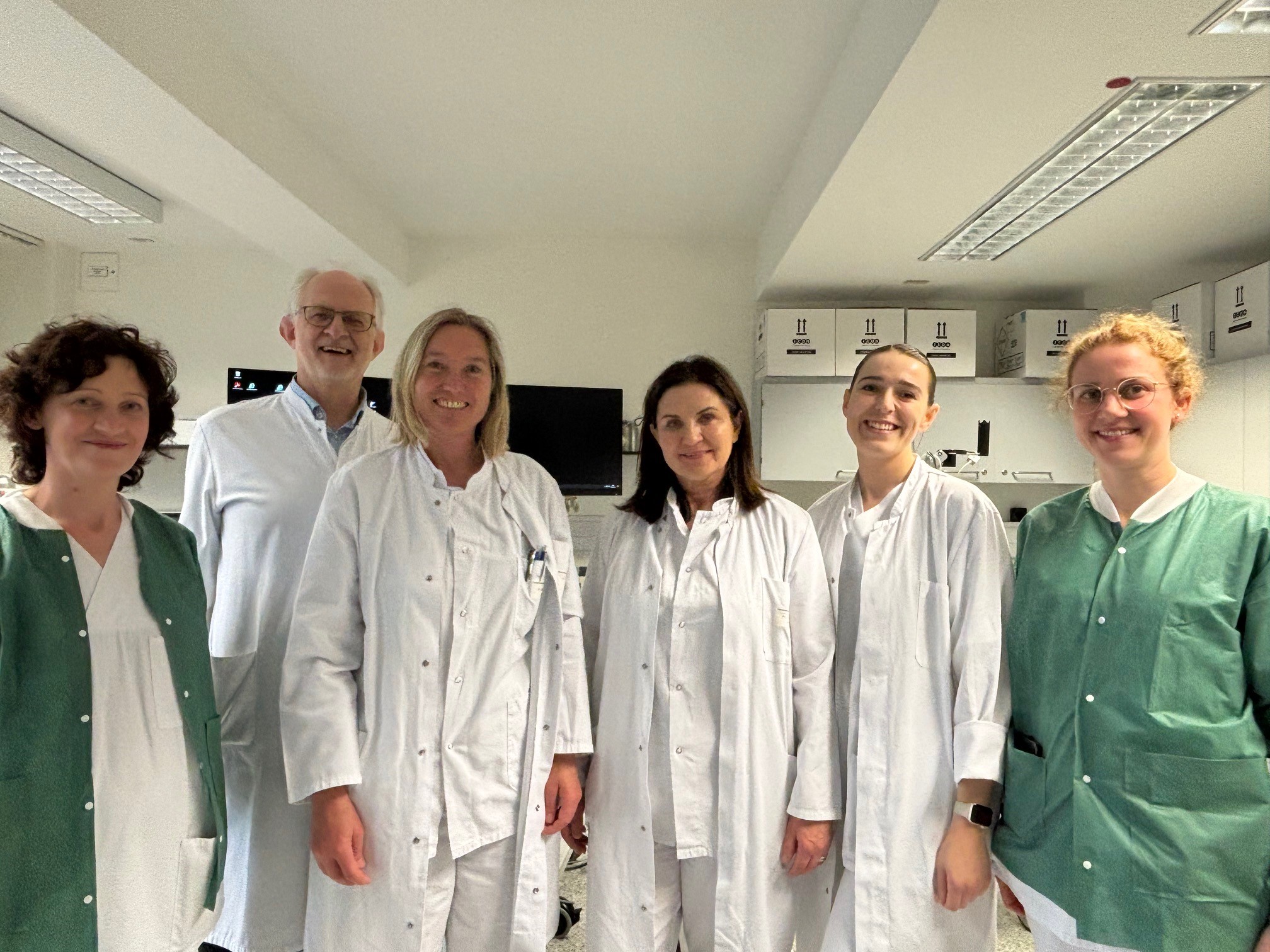Würzburg. Neue Wege in die Allgemeinmedizin. Nachwuchs für Versorgung und Forschung begeistern.“ So lautet das Motto der 58. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM), die vom 26. bis zum 28. September 2024 in Würzburg stattfindet. „Wir brauchen in Zukunft viele neue Hausärztinnen und Hausärzte im ganzen Land“, erklärt Prof. Dr. Anne Simmenroth, die gemeinsam mit Prof. Dr. Ildikó Gágyor das Institut für Allgemeinmedizin am Uniklinikum Würzburg (UKW) leitet. Die Direktorinnen, die beide einen Tag in der Woche in allgemeinmedizinischen Praxen in Würzburg arbeiten, freuen sich über einen regen Austausch zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Ärztinnen und Ärzten, Studierenden, Medizinischen Fachangestellten, Studienassistenz und Beschäftigen aus der Sozialarbeit, dem Gesundheitswesen, der Politik und allen Bereichen, die mit der hausärztlichen Versorgung zu tun haben.
Junge Menschen für die Allgemeinmedizin begeistern
„Gemeinsam mit allen Teilnehmenden möchten wir diskutieren, wie es uns gelingen kann, den Nachwuchs einzubinden und was wir brauchen, um junge Menschen weiterhin für die Allgemeinmedizin zu begeistern“, sagt Anne Simmenroth. „Der Nachwuchs ist der Grundstein für all unsere Zukunftspläne, ihn zu fördern ist die Voraussetzung für eine qualitativ hochwertige Versorgung, für die Forschung und für die Aus- und Weiterbildung in unserem Fach“, fährt Ildikó Gágyor fort. „Wenn wir hier nicht genug investieren, werden wir alt aussehen.“
Begegnung und Austausch der verschiedenen Generationen
Die Ausbildung beginnt bereits im Studium, und findet nicht nur in den Universitätsklinken statt, sondern maßgeblich in den hausärztlichen Praxen. „Wir brauchen daher die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen ganz stark in der Lehre, in den Blockpraktika und im Praktischen Jahr“, erinnert Anne Simmenroth, die am Institut für die Lehre und Lehrforschung zuständig ist. Nicht nur Hausärztinnen und Hausärzte aus der Region, sondern aus dem ganzen Land sind herzlich zum Kongress eingeladen. „Wir freuen uns, wenn sich die verschiedenen Generationen – etablierte und potentielle Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner – beim Kongress begegnen und austauschen.“
Buntes Programm in abwechslungsreichen Formaten und schönstem Ambiente
Ildikó Gágyor, die am Lehrstuhl den Schwerpunkt Versorgungsforschung betreut, verspricht ein buntes Programm in schönstem Ambiente, organisiert von einem hochmotivierten und extrem engagierten Team. „Neben der Nachwuchsförderung werden wir uns vielen weiteren Themen widmen, die in unserem Fach wichtig sind, von Klima und Gesundheit über Digitalisierung und E-Health bis hin zu Präventionskonzepten und Forschungsprojekten.“ Auch die Formate sind abwechslungsreich: Es wird eine Podiumsdiskussion geben, Plenar-, Poster- und „1 slide 5 minutes“-Vorträge sowie Symposien, Workshops, Arbeits- und Fachgruppentreffen und einen Science Slam.
Das „Leere Sprechzimmer“ und der „Reflective Practitioner“
Auch das „Leere Sprechzimmer“, das erstmals auf dem 55. DEGAM-Kongress in Lübeck gezeigt wurde, wird in Würzburg Platz finden. Die Wanderausstellung erinnert an die ärztlichen Opfer der NS-Diktatur. Damals waren nicht nur tausende, vor allem jüdische Ärztinnen und Ärzte Opfer geworden, sondern auch Kolleginnen und Kollegen zu Täterinnen und Tätern und Mitwissenden. Die Ausstellung wird bei jeder Jahrestagung mit einem regionalen Schwerpunkt installiert. Derzeit beschäftigen sich 20 Würzburger Medizinstudierende im Rahmen des Wahlfaches „Reflective Practitioner“ mit der Erinnerungs- und Gedenkarbeit an die Opfer des Nationalsozialismus in Würzburg.
Die Registrierung für den Kongress ist ab sofort möglich: https://degam-kongress.de/2024/
Hinweis:
Ein Video mit Prof. Dr. Anne Simmenroth und Prof. Dr. Ildikó Gágyor vom Institut für Allgemeinmedizin am Uniklinikum Würzburg (UKW) finden Sie ebenfalls auf der Kongress-Homepage: https://degam-kongress.de/2024/
Text: Kirstin Linkamp / UKW