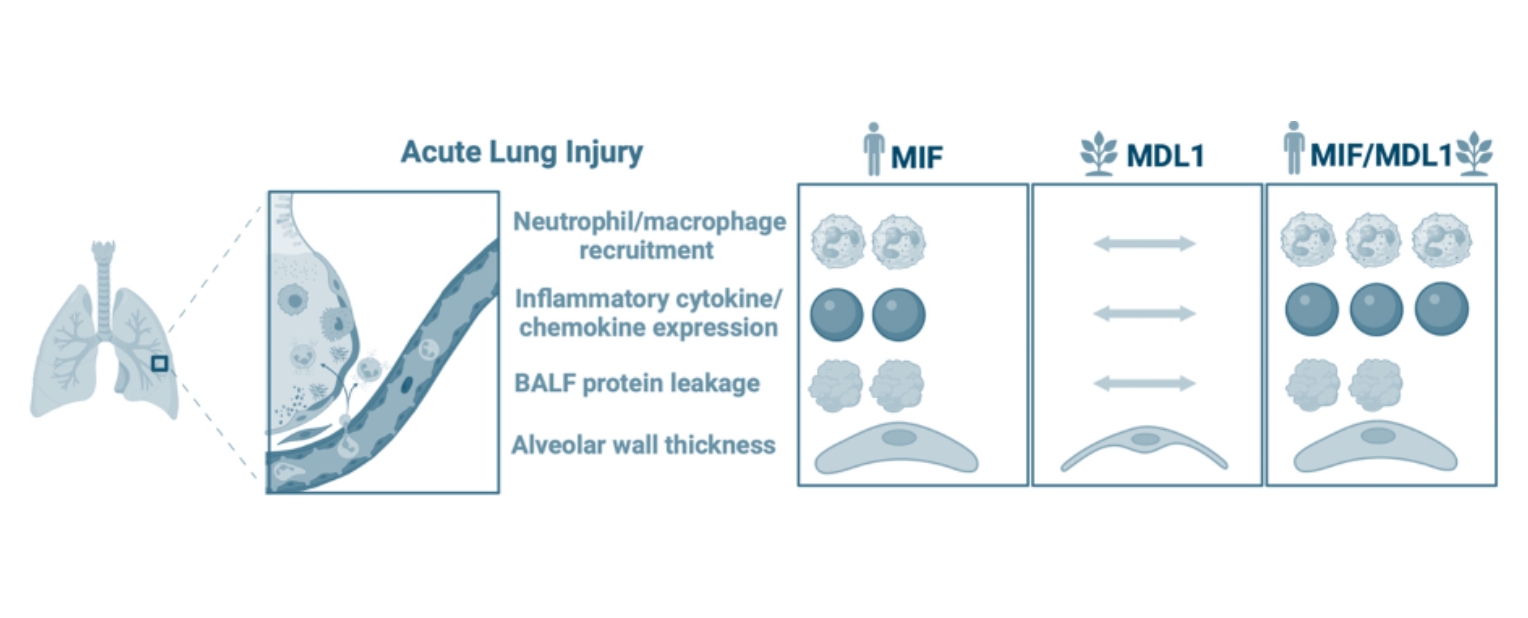Die vorgestellte prospektive Beobachtungsstudie untersucht Einflussfaktoren auf die Sicherheit und Verträglichkeit der Immuntherapie mit Bienen- bzw. Wespengift bei 1342 Patientinnen und Patienten aus 26 allergologischen Zentren in 8 europäischen Staaten. In 93 (7,0%) Fällen traten systemische Reaktionen während der Aufdosierungsphase der Immuntherapie auf, die unter Therapie mit Antihistaminika, Kortikosteroiden und – wenn erforderlich – Adrenalin stets gut beherrschbar waren. Eine Vorbehandlung mit oralen Antihistaminika hatte keinen Einfluss auf das Auftreten systemischer Reaktionen, beugte aber ausgeprägten lokalen Reaktionen an der Injektionsstelle wirksam vor. Starke lokale Schwellungen waren seltener, wenn ein mit Aluminium-hydroxid adjuvantiertes Depotpräparat für die Immuntherapie verwendet wurde. In Bezug auf das Risiko systemischer Nebenwirkungen unterschieden sich die Präparate verschiedener Hersteller nicht.
Arzt-Gradwohl L, Herzog SA, Aberer W, Alfaya Arias T, Antolín-Amérigo D, Bonadonna P, Boni E, Bożek A, Chełmińska M, Ebner B, Frelih N, Gawlik R, Gelincik A, Hawranek T, Hoetzenecker W, Jiménez Blanco A, Kita K, Kendirlinan R, Košnik M, Laipold K, Lang R, Marchi F, Mauro M, Nittner-Marszalska M, Poziomkowska-Gęsicka I, Pravettoni V, Preziosi D, Quercia O, Reider N, Rosiek-Biegus M, Ruiz-Leon B, Schrautzer C, Serrano P, Sin A, Sin BA, Stoevesandt J, Trautmann A, Vachová M, Sturm GJ. Factors Affecting the Safety and Effectiveness of Venom Immunotherapy. J Investig Allergol Clin Immunol. 2025 Feb 18;35(1):40-49. doi: 10.18176/jiaci.0967. Epub 2023 Nov 8. PMID: 37937715.