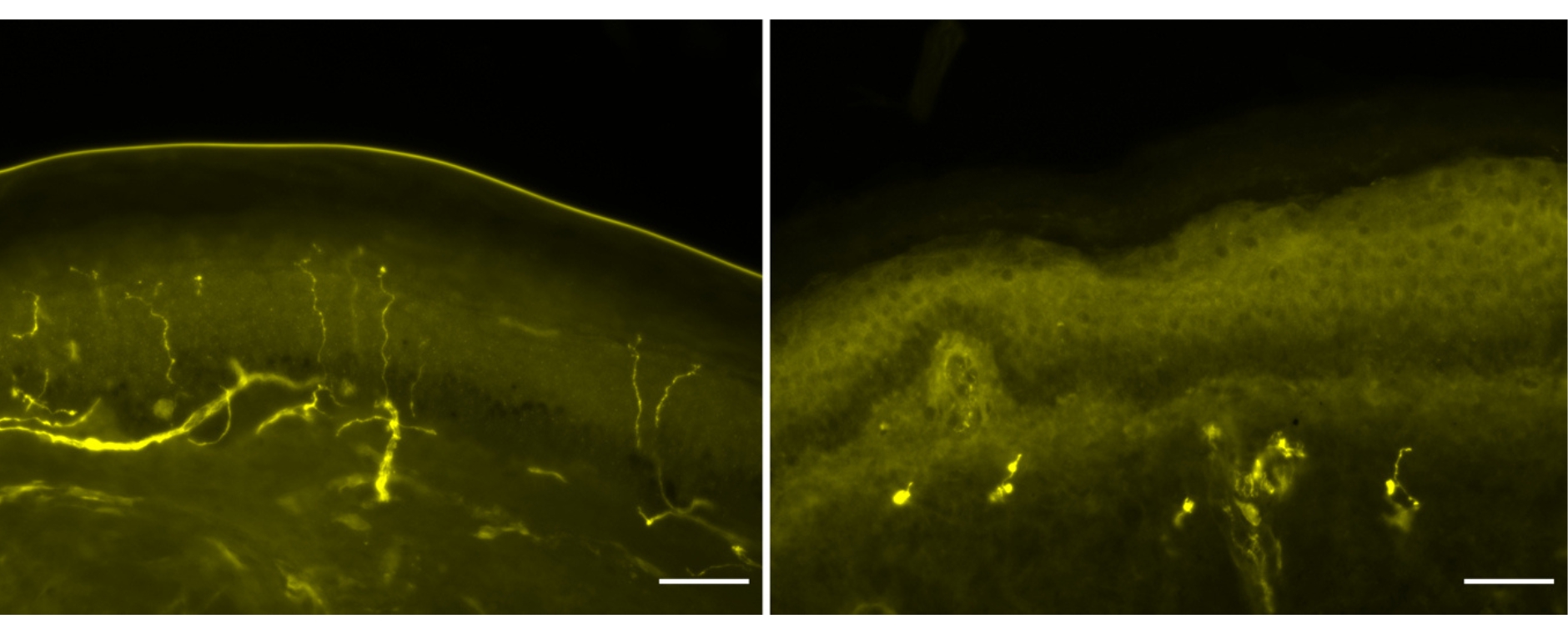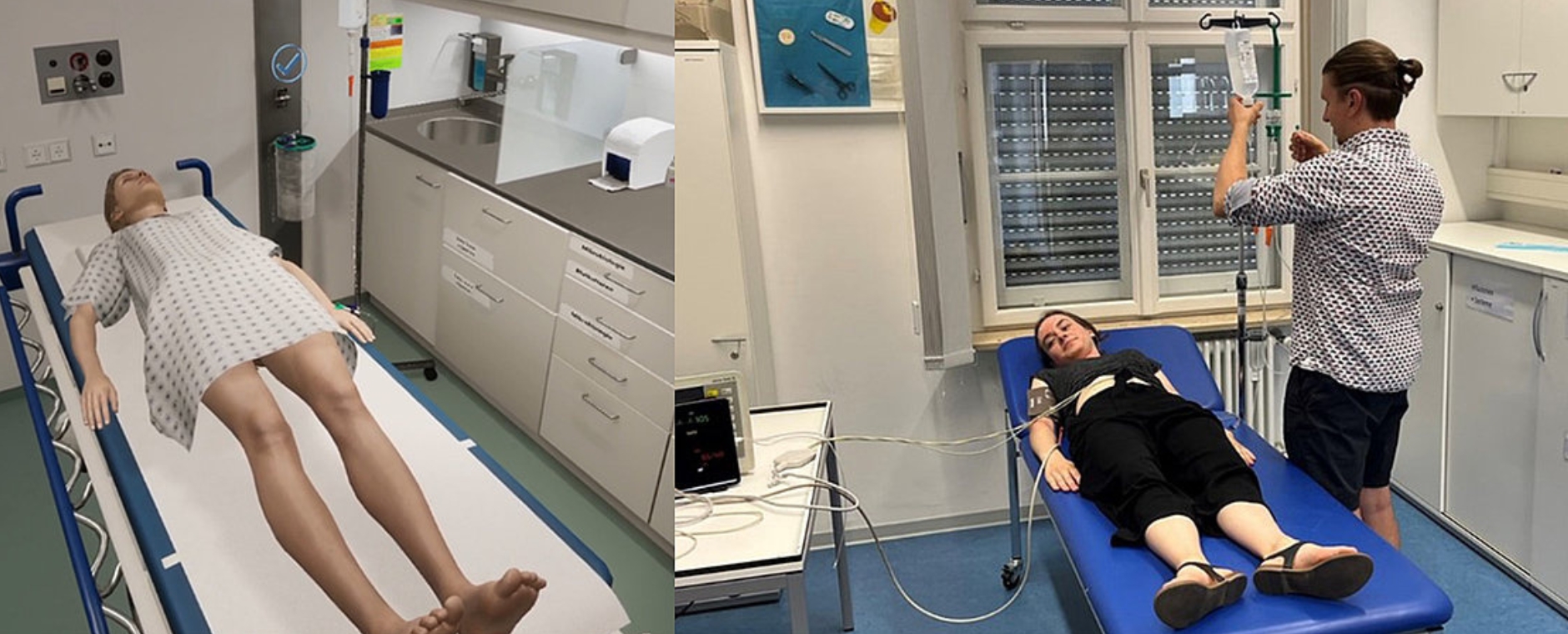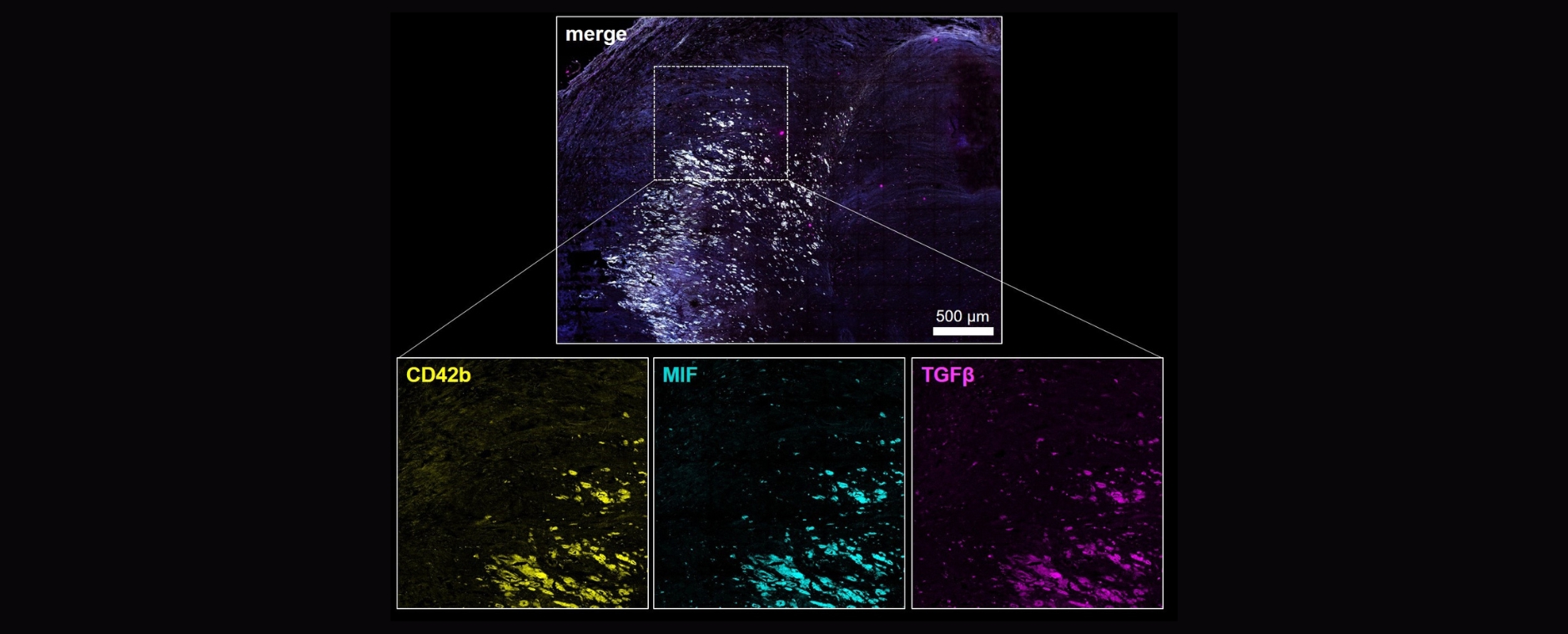51,5 % hatten ungedeckte Informationsbedürfnisse, 75,7 % einen hohen Unterstützungsbedarf und 31,2 % benötigten psychologische Unterstützung. Ältere Frauen zeigten tendenziell weniger Unterstützungsbedürfnisse.
Zufriedenheit mit Informationen korrelierte positiv mit physischer, sozialer und globaler Lebensqualität, während ungedeckte Bedürfnisse diese negativ beeinflussten. Nach einer Operation waren Informationsbedürfnisse höher als während der Chemotherapie.
Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung individuell angepasster Informations- und Unterstützungsangebote, um Lebensqualität und Behandlungsergebnisse zu verbessern.
Saskia-Laureen Herbert, AS Payerl, M Prange, S Löb, J Büchel, A Scherer-Quenzer, M Kiesel, A Wöckel, H Faller, K Meng. Supportive care and information needs in relation to quality of life among patients with breast cancer and gynaecological cancer during the time of treatment. Arch Gynecol Obstet. 2024 Nov 22. doi: 10.1007/s00404-024-07805-7. Epub ahead of print. PMID: 39576340.