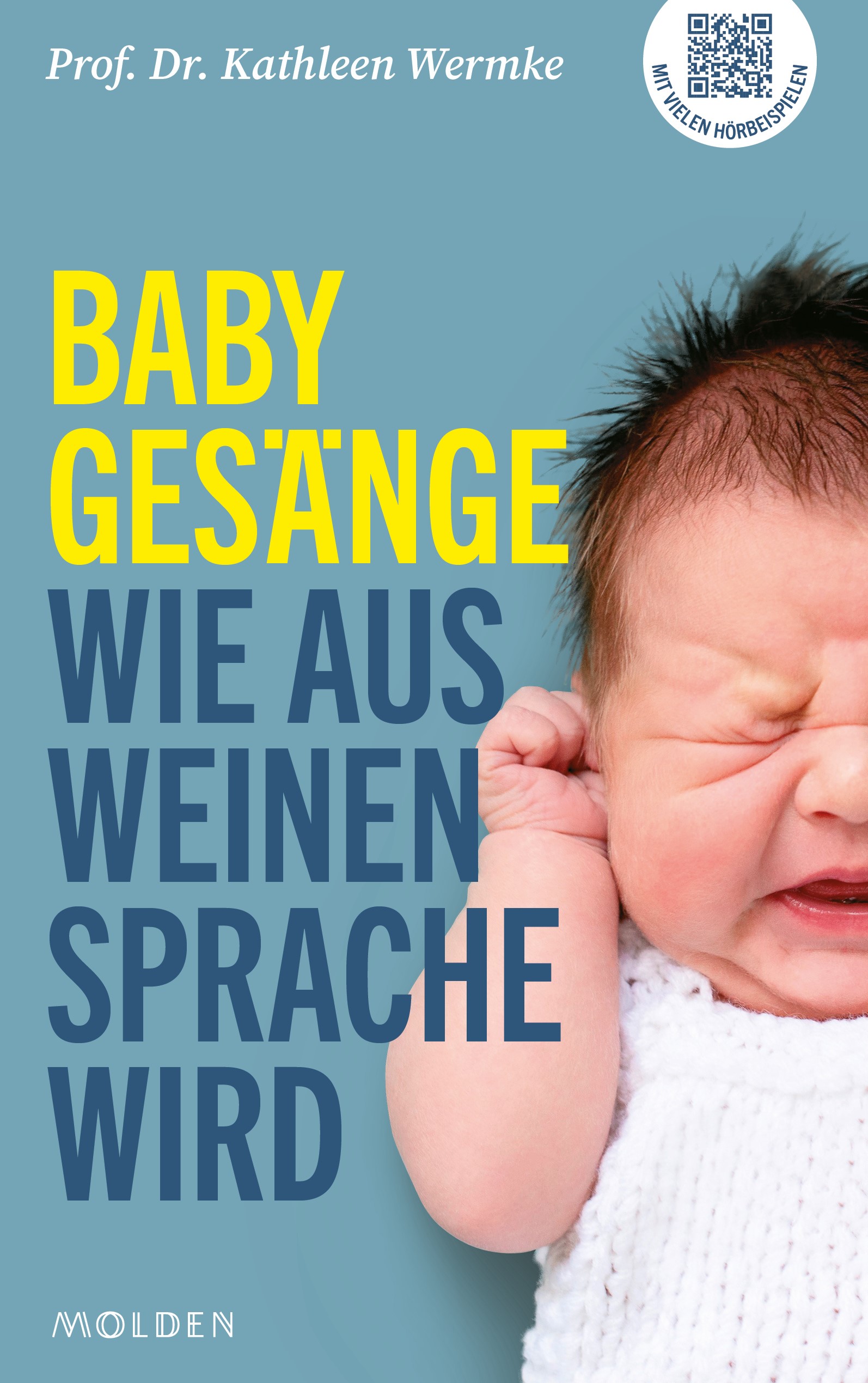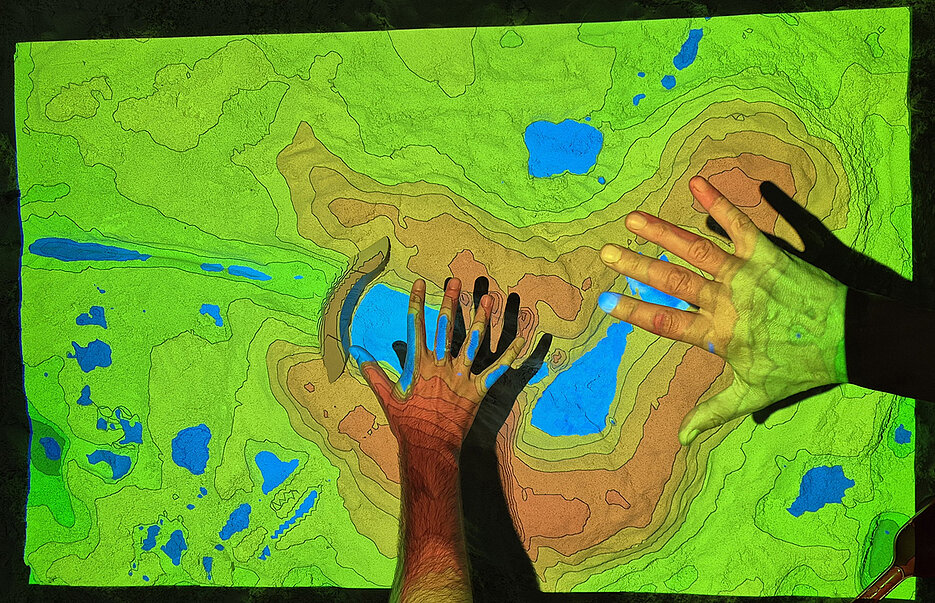Der Kongress der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft e.V. (DOG), der vom 25. bis zum 28. September in Berlin stattfand, trug in diesem Jahr das Leitthema „Ophthalmologie im Wandel – Gemeinsam die Zukunft gestalten“. Auch das Forschungsteam der Augenklinik des Universitätsklinikums Würzburg präsentierte wieder zahlreiche Innovationen, die die Augenheilkunde nachhaltig verändern und zu neuen therapeutischen Ansätzen inspirieren.
„Als Leiter unseres Forschungsteams bin ich unglaublich stolz auf die herausragenden Leistungen, die wir auf der DOG 2025 vorgestellt haben. Von den ersten 3D-Konjunktivalsphäroiden über sphäroidbasierte Mikrogewebe der Meibomdrüsen bis hin zu innovativen abbaubaren Hydrogelen mit Dexamethason – unser Team erweitert kontinuierlich die Grenzen der Augenforschung“, freut sich Dr. Malik Haider. „Unsere Arbeit ist mehr als nur Wissenschaft – sie ist eine Verpflichtung zur Entwicklung reproduzierbarer, patientenorientierter und translationaler Lösungen.“
Best Abstract Preis an Zhi Liang für die Biofabrikation dreidimensionaler konjunktivaler Sphäroide als In-vitro-Testsystem
Auf dem Kongress wurden zahlreiche Arbeiten ausgezeichnet. Zhi Liang erhielt den „Best Abstract“-Preis der AG Young DOG. Der mit 500 Euro dotierte Preis, gestiftet von Margarete Kramer, würdigt herausragende wissenschaftliche Arbeiten junger Augenärzte und Wissenschaftler aus dem gesamten Gebiet der Augenheilkunde. Zhi Liang präsentierte auf dem Kongress das erste dreidimensionale Konjunktival-Sphäroidmodell, das den Mangel an physiologisch relevanten In-vitro-Systemen für die Augenoberflächenforschung behebt.
Mithilfe spezieller wabenförmiger Zellkulturplatten aus Agarose – einem aus Rotalgen gewonnenen Zuckerbaustein – und menschlichen Bindehautzellen konnte Zhi Liang mit seinem Team kleine kugelförmige Mini-Gewebe, sogenannte Sphäroide, herstellen. Diese bestehen aus mehreren Zellschichten, ähnlich wie in der echten Bindehaut des Auges. „Unsere reproduzierbare und kostengünstige Plattform fördert mechanistische Studien und das Screening von Wirkstoffen, entspricht den 3R-Prinzipien und bietet Potenzial für personalisierte Augenbehandlungen“, erklärt Malik Haider.
Sicca-Preis für Biofabrikation von Mikrogewebe auf Sphäroidbasis von Meibom- und Tränendrüsen
Malik Haider selbst wurde mit dem mit 1.500 Euro dotierten Sicca-Preis ausgezeichnet. Auch er präsentierte eine Arbeit aus dem Bereich der Biofabrikation. Um dem Mangel an physiologisch relevanten Modellen für die Erforschung von Erkrankungen des trockenen Auges sowie für die Verabreichung von Augenmedikamenten entgegenzuwirken, entwickelte er sphäroidbasiertes Mikrogewebe aus Meibom- und Tränendrüsen. Meibomdrüsen sind kleine Talgdrüsen am Rand der Augenlider. Sie produzieren eine fettige Flüssigkeit, die sich als dünne Schicht auf den Tränenfilm legt und so verhindert, dass die Tränenflüssigkeit zu schnell verdunstet. Als Fettlieferanten des Tränenfilms sind sie entscheidend für gesunde, befeuchtete Augen.
Mithilfe skalierbarer 3D-Kulturverfahren gelang es Haider und seinem Team, die Zellen dazu zu bringen, sich zu gleichmäßigen, lebensfähigen, kugelförmigen Mini-Geweben zusammenzuschließen. Diese bewahrten die gewebespezifische Struktur und Funktion des echten Drüsengewebes. Die Methode ist einfach, günstig und gut reproduzierbar. Dadurch eignet sie sich hervorragend für die Erforschung von Krankheitsursachen, das Testen neuer Therapien und sogar für die personalisierte Augenmedizin. Außerdem erfüllt sie die 3R-Prinzipien, da sie Tierversuche deutlich reduzieren kann.
Zwei Poster des Tages
Darüber hinaus wurden zwei Posterbeiträge des Würzburger Teams als Poster des Tages ausgezeichnet. Dr. Raoul Verma-Führing wurde für die Entwicklung und Charakterisierung eines neuartigen Trägersystems für Augenmedikamente gewürdigt. Dabei handelt es sich um ein Gel auf Hyaloronsäure-Basis, das mit winzigen Mizellen gefüllt ist. Diese enthalten den Wirkstoff Dexamethason, ein starkes entzündungshemmendes Medikament. Das System zeigte eine ausgezeichnete Zytokompatibilität und ist somit zellverträglich sicher für das Auge. Es verfügt über ein stabiles Quellverhalten, kann also Wasser aufnehmen, ohne seine Stabilität zu verlieren. Zudem lässt es sich so einstellen, dass es sich im Auge langsam abbaut und den Wirkstoff gleichmäßig und über einen längeren Zeitraum freisetzt. Durch die Kombination von Lichtaktivierung beim Einsetzen und der empfindlichen Reaktion auf körpereigene Enzyme entsteht eine maßgeschneiderte und patientenfreundliche Methode zur wirksamen Behandlung von Augen über längere Zeiträume – ohne dass ständig neue Tropfen oder Injektionen nötig sind.
Das zweite Poster des Tages aus Würzburg stammte von Pia Schröder. In ihrer Arbeit machte die Assistenzärztin auf die Diskrepanz zwischen Ganglienzellanalyse in der optischen Kohärenztomografie (OCT) und Gesichtsfeldtests bei der Erkennung von (post-)chiasmatischen Läsionen aufmerksam. Das Chiasma ist die Kreuzung, an der sich die Sehnerven treffen, die die Signale vom Auge ins Gehirn leiten. Schädigungen oder Erkrankungen an oder hinter dieser Kreuzung können zu Gesichtsfeldausfällen führen. Auch ein Glaukom kann die Sehnerven schädigen und Einschränkungen im Gesichtsfeld verursachen. Es kann schwierig sein, eine Schädigung des Sehnervs durch ein Glaukom von einer Schädigung hinter der Sehnervenkreuzung im Gehirn zu unterscheiden. Mithilfe einer speziellen Bildgebungsmethode, der OCT-Ganglienzellanalyse, lässt sich die Nervenzellschicht der Netzhaut sehr genau untersuchen. Pia Schröder berichtete von drei Patienten, bei denen diese Analyse eine Verdünnung der Nervenzellschicht entlang der vertikalen Mittellinie zeigte, obwohl die üblichen Gesichtsfeldtests noch unauffällig waren. Weitere Untersuchungen ergaben einen Tumor der Hirnanhangsdrüse (Hypophysenadenom), eine Narbenbildung entlang der Sehnervenbahn (Gliose) sowie eine Läsion im Bereich des Kapselsattels/Hypothalamus. Die Ergebnisse zeigen, dass Veränderungen in der Ganglienzellschicht bereits in einem sehr frühen Stadium auftreten können, noch bevor Patienten Einschränkungen im Gesichtsfeld bemerken. Damit könnte die OCT-Analyse ein wichtiger Frühwarnhinweis sein.
Malik Haider resümiert: „Diese Auszeichnungen und Anerkennungen spiegeln nicht nur die individuelle Brillanz wider, sondern auch das kollektive Engagement, die Kreativität und die Ausdauer jedes einzelnen Teammitglieds.“
Die Kongressbeiträge der Augenklinik finden Sie hier.