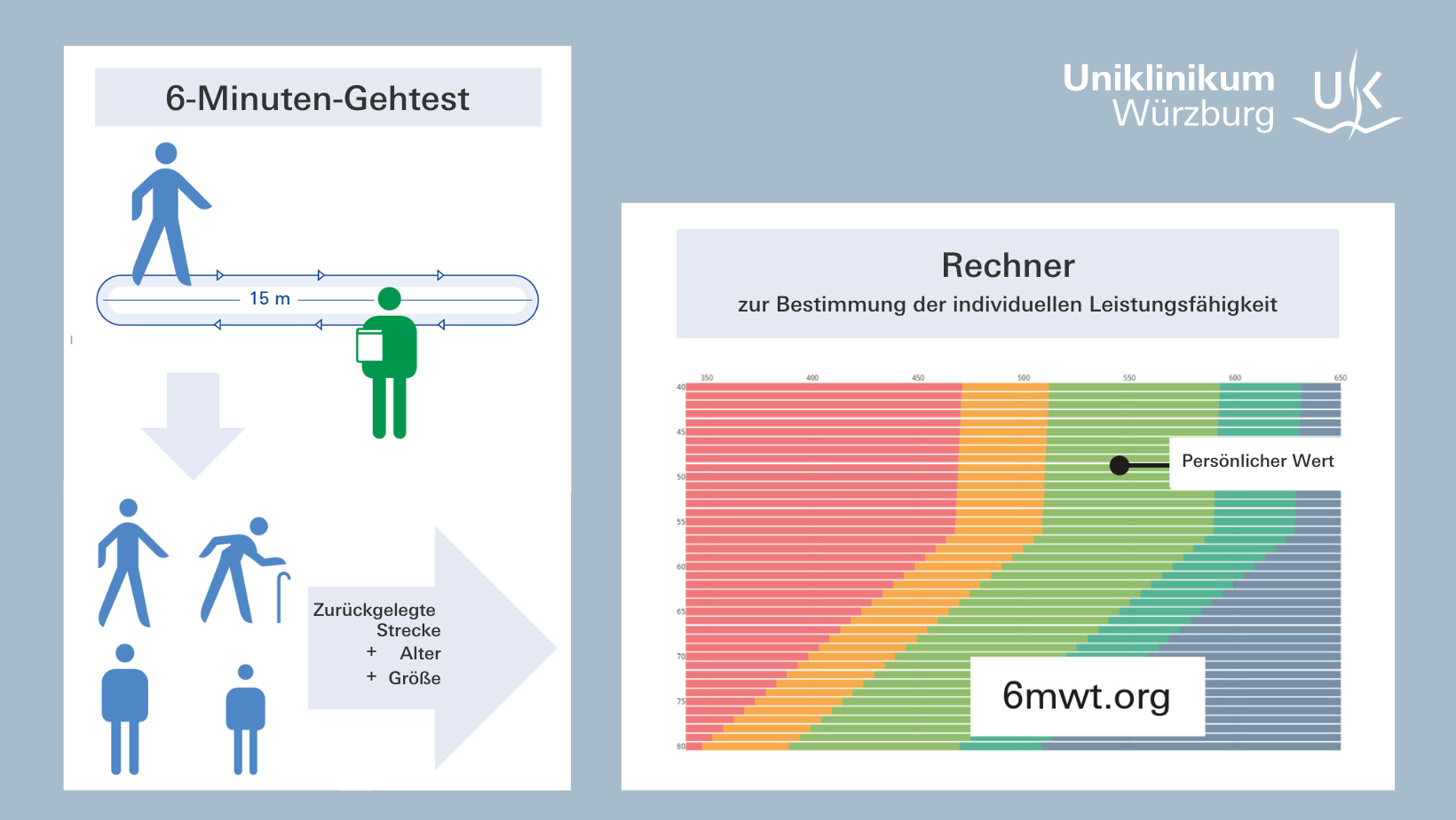In einer bahnbrechenden Studie hat ein Team um den Würzburger Professor José Pedro Friedmann Angeli nachgewiesen, dass die Cholesterinvorstufe 7-Dehydrocholesterol (7-DHC) eine entscheidende Rolle als Antioxidans spielt: Sie lagert sich in die Zellmembranen ein und schützt die Zellen, indem sie eine bestimmte Art des Zelltods verhindert, die so genannte Ferroptose.
Bislang wurde eine Anhäufung der Cholesterinvorstufe 7-DHC nur mit neurologischen Entwicklungsstörungen in Verbindung gebracht, jetzt zeigen wir, dass sie die zelluläre Fitness erhöht und bei Krebsarten wie dem Burkitt-Lymphom und dem Neuroblastom ein aggressiveres Verhalten fördern könnte“, sagt Friedmann Angeli.
Die neu entdeckte Schutzfunktion von 7-DHC eröffne nun spannende Perspektiven, um die Behandlung von Krebs und anderen mit Ferroptose verbundenen Krankheiten weiter zu verbessern: „Das gibt uns neue Möglichkeiten, potenzielle Hemmstoffe zu prüfen, die auf die Cholesterinbiosynthese abzielen und bereits in der medizinischen Praxis etabliert sind.“
Teams aus Würzburg, Dresden, München und Heidelberg beteiligt
Das berichten die Forschenden im Journal Nature. An der Studie haben neben dem Würzburger Team vom Rudolf Virchow Zentrum – Center for Integrative and Translational Bioimaging mitgewirkt: Maria Fedorova (Technische Universität Dresden), Marcus Conrad (Helmholtz Munich) Derek Pratt (Universität Ottawa) sowie Andreas Trumpp und Hamed Alborzinia (Deutsches Krebsforschungszentrum DKFZ Heidelberg).
Veränderungen im 7-DHC-Spiegel beobachten
Ein hoher Cholesterinspiegel wird mit Gesundheitsproblemen wie Herzproblemen und Diabetes in Verbindung gebracht. Die meisten Studien konzentrieren sich darauf, wie Cholesterin direkt zu diesen Erkrankungen beiträgt.
Auf diesem Gebiet eröffnet die Entdeckung der Cholesterinvorstufe 7-DHC als Antioxidans neue Möglichkeiten: Studien über Veränderungen im 7-DHC-Spiegel könnten entscheidende neue Erkenntnisse über die Erkrankungen liefern. Darüber hinaus sollten Medikamente, die speziell die 7-DHC-Produktion blockieren, in Kombination mit anderen Medikamenten erforscht werden – das könnte bei der Therapie mancher Krebserkrankungen positiv wirken.
Mögliche Auswirkungen auf die Tumorentwicklung
„Unser nächstes Forschungsziel ist es, die Auswirkungen der 7-DHC-Akkumulation während der Tumorentwicklung zu untersuchen“, sagt der Würzburger Ferroptose-Experte José Pedro Friedmann Angeli.
Das Team, das für die Publikation in Nature verantwortlich zeichnet, plädiert außerdem für weitergreifende epidemiologische Studien. Hintergrund: Es gibt von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zugelassene Medikamente, die das Enzym DHCR7 hemmen können. Dazu gehört Trazodon, das in den USA jährlich rund 20 Millionen Mal verschrieben wird, manchmal sogar für den Off-Label-Gebrauch zur Behandlung von Schlaflosigkeit.
„Studien haben gezeigt, dass Personen, die dieses Medikament einnehmen, erhöhte Plasmaspiegel von 7-DHC aufweisen. Um hier mögliche Auswirkungen besser zu verstehen, sind epidemiologische Studien von entscheidender Bedeutung“, sagt Friedmann Angeli. Diese Studien würden helfen herauszufinden, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Patientengruppen, die regelmäßig ferroptosemodulierende Medikamente wie Trazodon einnehmen, und der Krebsinzidenz, dem Auftreten von Metastasen oder anderen kritischen Aspekten der öffentlichen Gesundheit.
Publikation
7-Dehydrocholesterol is an endogenous suppressor of ferroptosis. Nature, 31. Januar 2024, DOI: 10.1038/s41586-023-06878-9, www.nature.com/articles/s41586-023-06878-9
Förderer
Die Studie wurde finanziell gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), dem Interdisziplinären Zentrum für Klinische Forschung (IZKF) Würzburg und der José Carreras Leukämie Stiftung.
Kontakt
Prof. Dr José Pedro Friedmann Angeli, Rudolf Virchow Zentrum – Center for Integrative and Translational Bioimaging, Universität Würzburg, Comprehensive Cancer Centre (CCC) Mainfranken und Bayerisches Zentrum für Krebsforschung (BZKF), pedro.angeli@ virchow.uni-wuerzburg.de
Pressemitteilung der Julius-Maximilians-Universität (JMU) Würzburg vom 31. Januar 2023