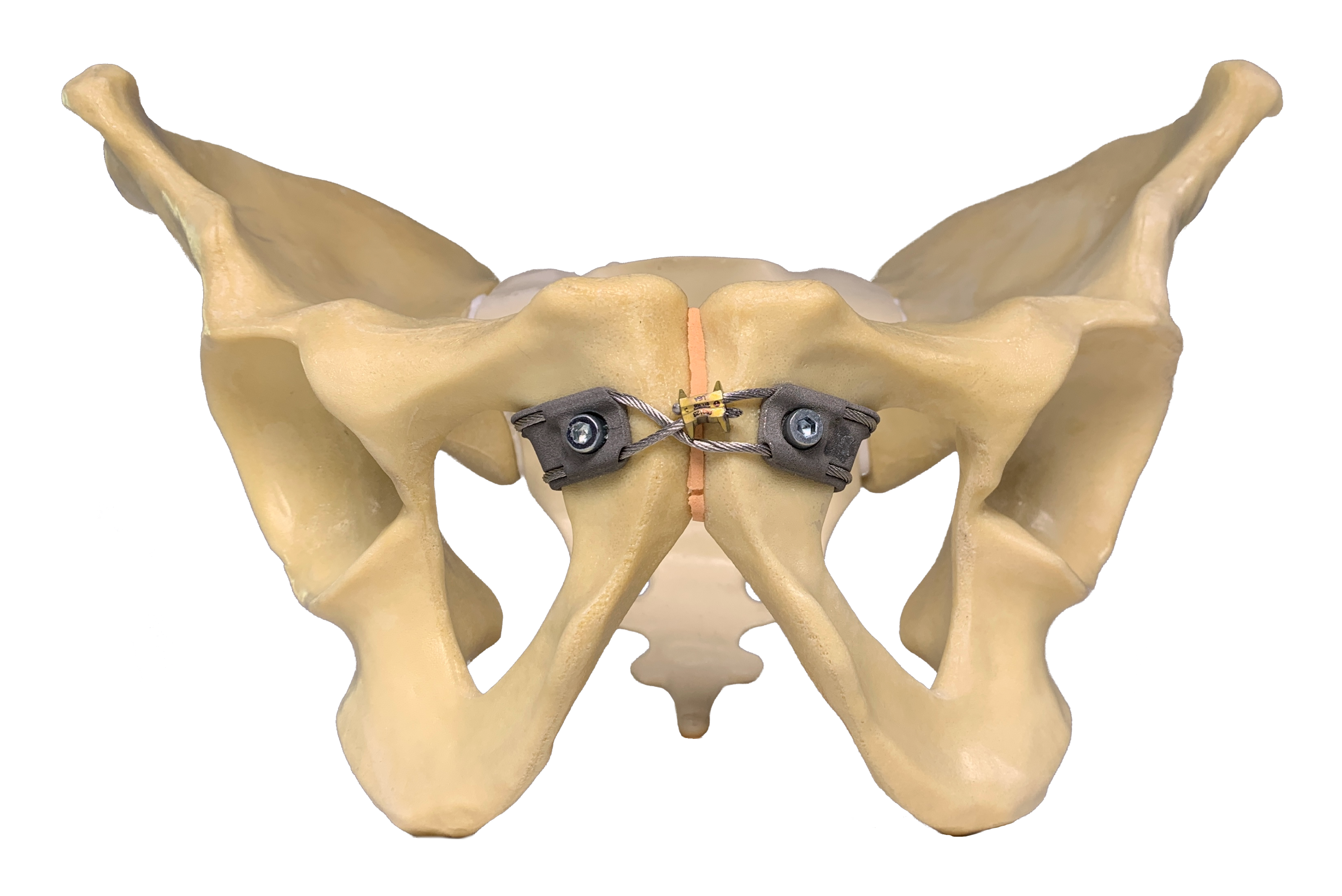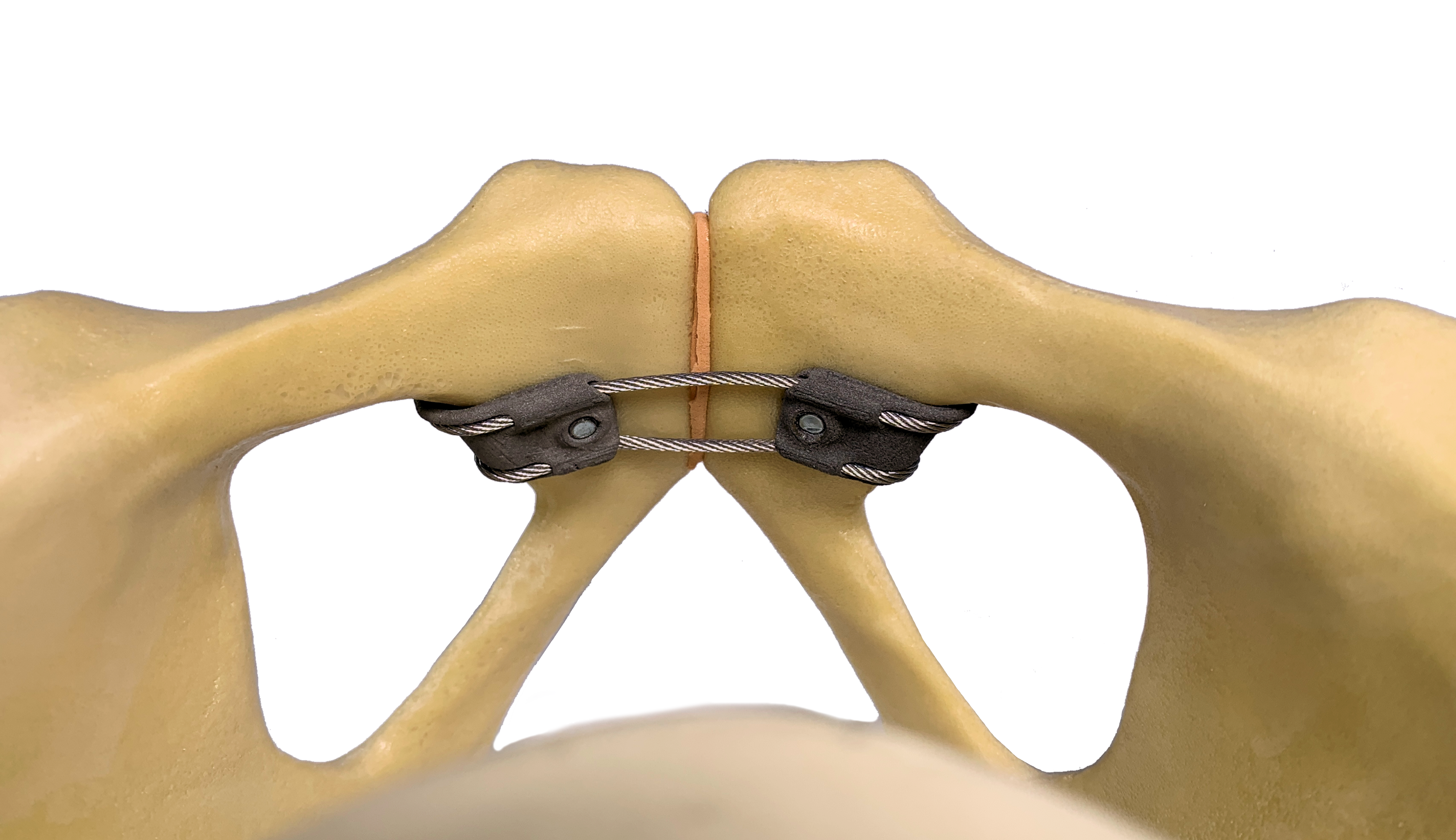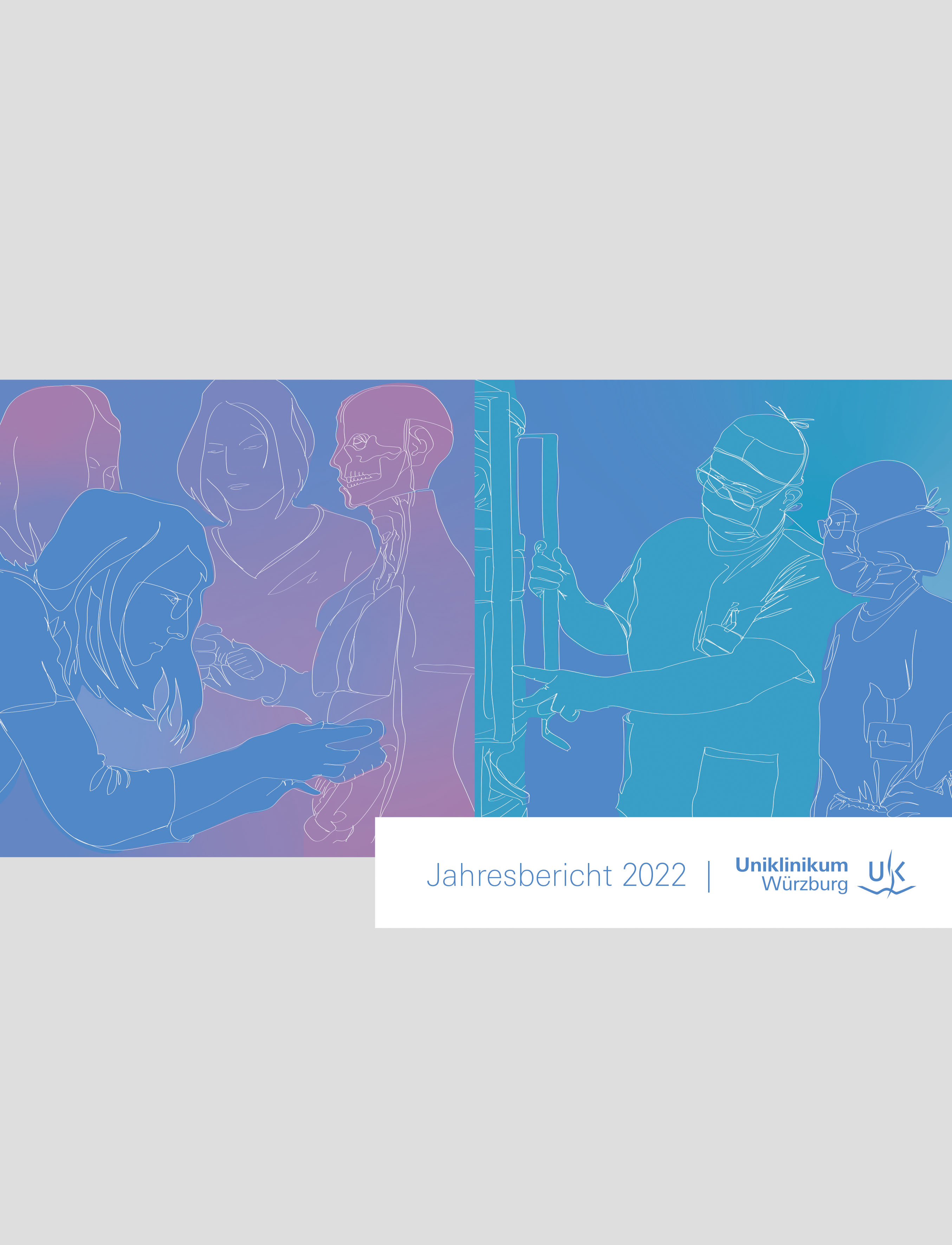Gene aus der MYC-Familie sind für den menschlichen Organismus essenziell. Nach derzeitigen Erkenntnissen regulieren sie die Expression der meisten zellulären Gene. Eine Fehlsteuerung von MYC-Proteinen trägt wesentlich zur Entstehung vieler Arten von Krebs bei. Kein Wunder, dass MYC-Proteine im Fokus der Krebsforschung weltweit stehen. Aus Sicht der Wissenschaft könnten sie das ideale Ziel für neue Wirkstoffe im Kampf gegen Krebs sein.
Tatsächlich ist die Bedeutung von MYC für die Entwicklung von Krebszellen seit Langem bekannt. Die Struktur der MYC-Proteine und ihre molekulare Funktion haben es allerdings bisher verhindert, das Protein direkt pharmakologisch anzugreifen. Bei der Suche nach einer Lösung für dieses Problem ist einem Forschungsteam der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) jetzt möglicherweise ein wichtiger Schritt geglückt: Über einen Kooperationspartner von MYC konnte es im Tierversuch die Entstehung und Entwicklung der Krebstumoren deutlich bremsen.
Publikation in „Life Science Alliance”
Beteiligt an der Studie waren zwei Arbeitsgruppen am Lehrstuhl für Biochemie und Molekularbiologie der JMU von Wolf Elmar, Professor für Tumorsystembiologie, und von Dr. Peter Gallant sowie die Gruppe von Thomas Raabe, Professor für Molekulare Genetik. Die Ergebnisse ihrer Arbeit haben die Wissenschaftler jetzt in der Fachzeitschrift „Life Science Alliance“ veröffentlicht.
„Weil es so schwierig ist, MYC-Proteine direkt anzugreifen, haben wir nach Partnern von MYC gesucht und dabei ein Protein namens SPT5 gefunden“, schildert Elmar Wolf die Vorarbeiten zu dieser Studie. SPT5 stellte sich in der Zellkultur als unverzichtbar für die MYC-abhängige Gen-Transkription in menschlichen Krebszellen heraus. Unklar blieb allerdings, wie wichtig die Interaktion von MYC- und SPT5-Proteinen für das Verhalten von normalen Zellen im Körper ist und ob sich über sie die Entwicklung von Krebszellen würde beeinflussen lassen.
Forschung an der Fruchtfliege
Antworten liefert die jetzt veröffentlichte Studie. „Wir haben mit der Fruchtfliege Drosophila melanogaster gearbeitet – einem bekannten und bewährten Modellsystem der tierischen Entwicklung“, erklärt Peter Gallant. Genauso wie Wirbeltiere – und somit auch der Mensch – besitzen Fruchtfliegen ebenfalls MYC- und SPT5-Proteine.
In ihren Experimenten konnten die Wissenschaftler in einem ersten Schritt nachweisen, dass MYC- und SPT5-Proteine auch im Organismus der Fruchtfliege funktionell zusammenarbeiten. So wurde beispielsweise eine moderate Veränderung der MYC- oder der SPT5-Menge von den Fliegen gut toleriert. Veränderte das Team jedoch sowohl MYC- als auch SPT5-Mengen gleichzeitig, traten bei den Tieren deutliche Defekte auf. „Diese Beobachtungen unterstreichen die Wichtigkeit der MYC-SPT5-Interaktion während der normalen Entwicklung des Organismus“, sagt Thomas Raabe.
Drastische Reduktion des Tumorgewebes
Im nächsten Schritt ging das Forschungsteam der Frage nach, welche Rolle SPT5 bei der Entstehung und Entwicklung von Tumoren einnimmt. Zum Einsatz kamen dafür gentechnisch veränderte Fruchtfliegen, die MYC-abhängige Hirntumoren entwickeln. Im Experiment konnten diese Fliegen zwar schlüpfen, starben aber innerhalb von weniger als zehn Tagen, wohingegen die meisten Kontrolltiere nach zwei Monaten noch am Leben waren.
„Wenn wir jedoch bei diesen Exemplaren die Menge an SPT5 in den Hirntumoren experimentell reduzierten, verdreifachte sich ihre Lebenszeit“, schildert Peter Gallant das zentrale Ergebnis der Studie. Dies ging einher mit einer dramatischen Abnahme der Tumormasse, die allerdings nur vorübergehend war. Die Lebenszeit verlängerte sich auch dann, wenn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die SPT5-Menge nicht nur im Gewebe der Hirntumoren reduzierten, sondern im gesamten Organismus der Fliege. Analoge Manipulationen der SPT5-Menge in gesunden Kontrolltieren hatten nur vernachlässigbare Auswirkungen auf die Gehirnstruktur und das Überleben der Tiere.
Nach Aussicht der Würzburger Arbeitsgruppen zeigen diese Resultate, dass SPT5 eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von MYC-abhängigen Tumoren spielt. Ihre Experimente lassen auch den Schluss zu, dass eine moderate Reduktion von SPT5 in gesundem Gewebe gut toleriert wird, aber zu einer deutlichen Rückbildung von Tumoren führen kann. Damit erweise sich SPT5 als ein mögliches Zielprotein für die Entwicklung von pharmakologischen Hemmstoffen für die Krebsbekämpfung.
Originalpublikation
Spt5 interacts genetically with Myc and is limiting for brain tumor growth in Drosophila. Julia Hofstetter, Ayoola Ogunleye, André Kutschke, Lisa Marie Buchholz, Elmar Wolf, Thomas Raabe, Peter Gallant. Life Science Alliance Vol 7, Issue 1; doi: 10.26508/lsa.202302130.
Kontakt
Dr. Peter Gallant, Lehrstuhl für Biochemie und Molekularbiologie, peter.gallant@uni-wuerzburg.de
Pressemeldung der Universität Würzburg vom 07.11.2023