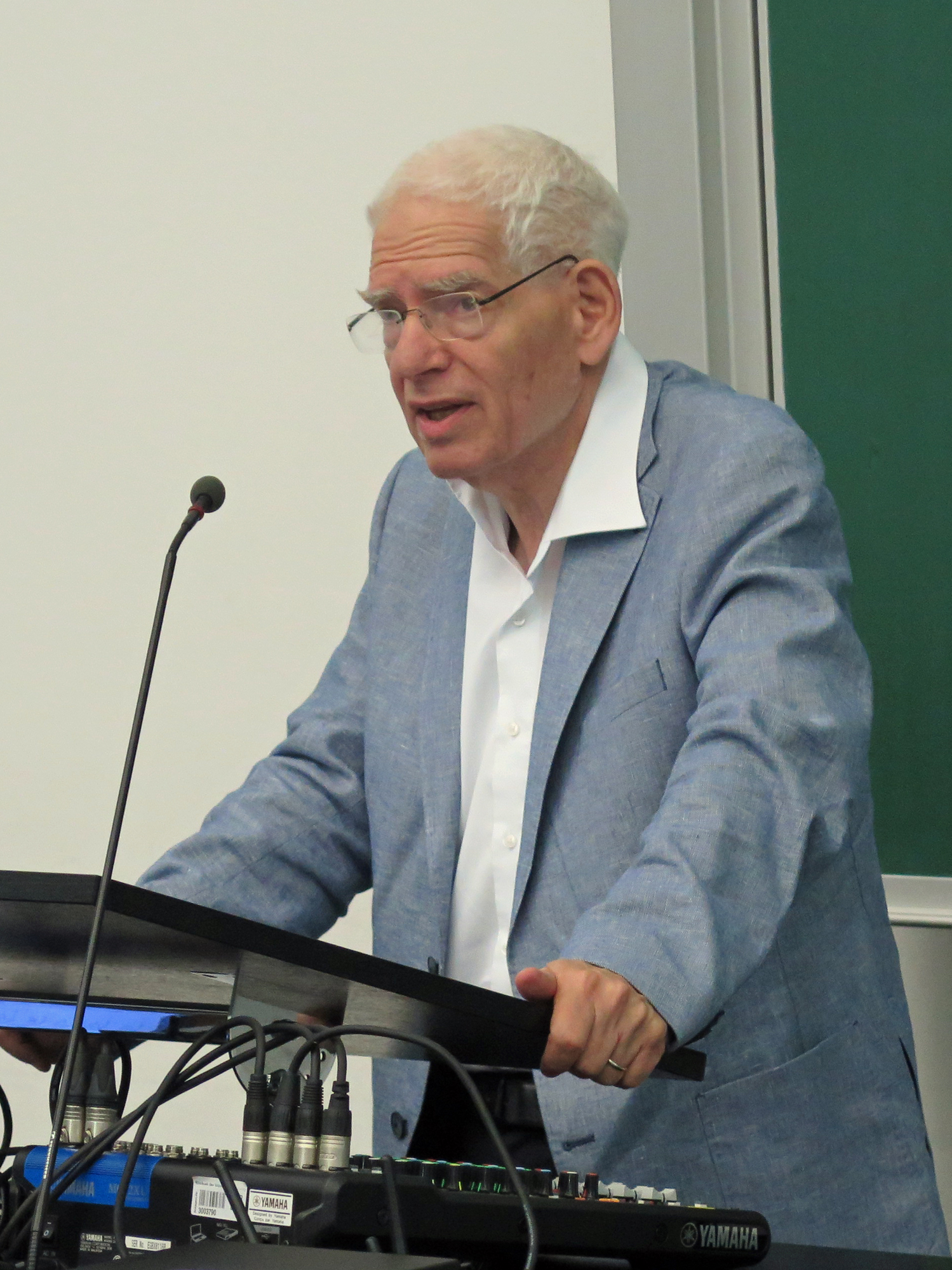Würzburg. Das Klinische Ethikkomitee (KEK) des Uniklinikums Würzburg (UKW) organisiert einmal im Jahr seinen Ethiktag. Die diesjährige, 15. Neuauflage der öffentlichen Vortrags- und Diskussionsveranstaltung fand am 30. Juni 2025 statt. Rund 200 Teilnehmende kamen in den Hörsaal des Rudolf-Virchow-Zentrums auf dem Klinikumscampus an der Würzburger Josef-Schneider-Straße, um die Ausführungen von Dr. Dr. h.c. Josef Schuster als Mitglied des Deutschen Ethikrats zu hören. Im Zentrum standen dabei die medizinischen Themen, mit denen sich das bekannte Gremium aktuell beschäftigt – oder in der jüngeren Vergangenheit beschäftigt hat.
Einleitend beschrieb Privatdozentin Dr. Elisabeth Jentschke die Aufgaben und die Struktur des von ihr geleiteten KEK. Dem unabhängigen Komitee gehören Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Berufsgruppen am UKW an. Auf Wunsch beraten sie bei ethischen Fragen in der Patientenversorgung und im Arbeitsalltag.
„Wo Medizin auf das Leben trifft, ist Ethik immer im Raum“, unterstrich Prof. Dr. Tim J. von Oertzen in seiner Begrüßungsansprache. Der Ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende des UKW fuhr fort: „Ethische Fragestellungen sind daher keine Randthemen, sondern integraler Bestandteil ärztlicher und pflegerischer Praxis – und werden es in Zukunft noch in viel höherem Maße sein. Nicht nur, weil die Möglichkeiten der modernen Medizin zunehmen, sondern auch, weil sich gesellschaftliche Vorstellungen von Krankheit, Gesundheit, Autonomie und Verantwortung verändern.“
Mediziner und Vertreter des jüdischen Glaubens
Der Deutsche Ethikrat gibt mit seinen Stellungnahmen und Empfehlungen Orientierung für Gesellschaft und Politik (siehe Kastentext). Dr. Josef Schuster (Jahrgang 1954) gehört der Einrichtung seit dem Jahr 2020 an. Der Würzburger Internist und Notarzt ist bundesweit bekannt als Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Er vertritt im Ethikrat nicht nur eine Perspektive als Mediziner, sondern fungiert auch als Vertreter des jüdischen Glaubens und dessen ethischen Vorstellungen.
Kritischer Blick auf die Stellungnahme zur Corona-Pandemie
In seiner ersten Amtsperiode im Ethikrat zwischen 2020 und 2024 zählte die Corona-Pandemie zu den zentralen Themen. Dabei erarbeitete der Rat im Jahr 2020 eine mit über 300 Seiten ungewöhnlich umfangreiche Stellungnahme. „Damals wurden viele Perspektiven der Bundesregierung positiv bewertet“, berichtete Dr. Schuster in seinem Vortrag. Retrospektiv müsse man aber immer auch den damaligen Kenntnisstand berücksichtigen. „Wir wissen heute alle, dass einige der Dinge, die im Rahmen der Pandemie auch gesetzgeberisch veranlasst wurden, wohl deutlich über das Ziel hinausgeschossen sind“, unterstrich der Referent. Besonders überraschend und erschreckend sei für ihn persönlich in der Folge gewesen, wie sehr speziell die Jugendlichen psychisch unter Maßnahmen wie Home Schooling und Kontaktbeschränkungen gelitten hätten.
Eine weitere Stellungnahme seiner ersten Amtsperiode beschäftigte sich mit der Mensch-Maschine-Interaktion. Für Dr. Schuster war hier die entscheidende Aussage: Künstliche Intelligenz ist segensreich, aber das letzte Wort muss immer der Mensch haben.
Aktuell: Diskussion um Gestaltung und Finanzierung der Pflege
Im Januar 2025 entschied der Ethikrat, sich intensiv mit dem Wohl pflegebedürftiger Menschen und ihrer Pflegenden auseinanderzusetzen – sowohl in Heimen als auch in der häuslichen Pflege. „Dabei geht es zum einen um den Mangel an pflegenden Personen und zum anderen um Finanzierungsfragen“, schilderte Josef Schuster. Nach seinen Worten wird im Ethikrat aktuell sehr kontrovers diskutiert, wie man sich zu Vollzeitkräften in der häuslichen Pflege, die meist aus osteuropäischen Ländern kommen, stellen soll. „Kritiker sehen hier eine Form der Ausbeutung. Außerdem würden durch diese Praxis Menschen aus ihren Heimatländern abgezogen, in denen auch ein Pflegebedarf besteht“, so der Mediziner. Aus eigenen Beobachtungen heraus empfindet er dieses Modell für finanziell entsprechend Ausgestattete als sinnvoll und für die Pflegenden in der Regel als fair. Außerdem funktioniere die häusliche Pflege in den Herkunftsländern trotz der „Abwanderung“ in Länder wie Deutschland nach wie vor gut.
Das weitaus größere Problem ist für ihn die Finanzierung. Er rechnete vor: „Bei der 1995 gestarteten Pflegeversicherung lag der Beitrag für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei 0,3 Prozent des Gehaltes. Inzwischen müssen drei Arbeitnehmer eine pflegende Person finanzieren und die Demographen sagen für 2040 ein Verhältnis 2:1 voraus. Das bedeutet, dass dann 5,3 Prozent des Gehalts erforderlich sind, in 2060 bei gleichen Voraussetzungen wie heute 8,5 Prozent. Das ist ein Problem, um dessen Lösung ich die Politik nicht beneide.“ Der Ethikrat werde sich in den kommenden Wochen und Monaten damit befassen, wie das Ganze vielleicht auf bessere, gesündere Füße gestellt werden könne.
Persönliche Standpunkte zu vielen weiteren Themen
In der auf seinen Vortrag folgenden Diskussion mit dem Moderator Andreas Jungbauer und dem Auditorium wurden Standpunkte des Experten zu vielen weiteren ethischen Herausforderungen abgefragt. Hier einige Beispiele:
Bei der Organspende würde Dr. Schuster die Widerspruchslösung mitgehen. Er wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die jüdische Ethik mittlerweile Organspende erlaubt.
Was das Problem der zukünftigen Finanzierbarkeit medizinischer Leistungen angeht, sagte das Ethikrat-Mitglied: „Nicht alles, was gut tut, wird finanzierbar bleiben. Man muss das aktuelle Leistungsspektrum kritisch hinterfragen, was ist im wahrsten Sinne des Wortes lebenswichtig und was zwar das Wohlbefinden steigert und vielleicht nicht lebenswichtig ist.“ Dem zum Beispiel in Großbritannien verfolgten Konzept, das Lebensalter als Kriterium für die Verfügbarkeit bestimmter medizinischen Versorgungsleistungen wie künstliche Hüftgelenke heranzuziehen, erteilte Dr. Schuster eine klare Absage.
Auch beim ärztlich assistierten Suizid hat Dr. Schuster im Einklang mit der jüdischen Ethik eine eindeutige Haltung: Es steht dem Menschen nicht zu, das Leben zu beenden – egal wie, egal mit welchen Maßnahmen. In diesem Zusammenhang bedankte sich Dr. Elisabeth Jentschke für ein entsprechendes Positionspapier des Deutschen Ethikrats. „Es darf nicht sein, dass sich Menschen, die glauben, gesellschaftlich nichts mehr wert zu sein, subtil zum ärztlich assistierten Suizid gedrängt fühlen“, betonte die Leiterin des KEK.
Hohe Anerkennung für die Arbeit des Klinischen Ethikkomitees
Auf die Frage, wie er insgesamt die Bedeutung der Arbeit des Deutschen Ethikrats beurteile, sprach Dr. Schuster von seiner Empfindung eines eher mäßigen Einflusses des Gremiums – insbesondere auf die Politik. Im Vergleich schätzte er die Wirksamkeit eines Klinischen Ethikkomitees als bedeutend höher ein: „Hier geht es um konkrete Fragen, die sich im Klinikalltag ergeben. Die Bedeutung des KEK wird vor dem Hintergrund der steigenden medizinischen Möglichkeiten weiter steigen.“
Über den Deutschen Ethikrat
Bei seinem Vortrag auf dem Ethiktag gab Dr. Schuster auch einen Überblick über die Struktur des Deutschen Ethikrates. Die Rechtsgrundlage des im Jahr 2007 eingerichteten Gremiums bildet das deutsche Ethikratgesetz. Laut Definition verfolgt der Ethikrat die ethischen, gesellschaftlichen, naturwissenschaftlichen, medizinischen und rechtlichen Fragen sowie die voraussichtlichen Folgen für Individuum und Gesellschaft, die sich im Zusammenhang mit der Forschung und den Entwicklungen insbesondere auf dem Gebiet der Lebenswissenschaften und ihrer Anwendung auf den Menschen ergeben. Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere:
- die Information der Öffentlichkeit und die Förderung der Diskussion in der Gesellschaft unter Einbeziehung der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen,
- die Erarbeitung von Stellungnahmen sowie von Empfehlungen für politisches und gesetzgeberisches Handeln,
- die Zusammenarbeit mit nationalen Ethikräten und vergleichbaren Einrichtungen anderer Staaten und internationaler Organisationen.
Seine Mitglieder werden von der Bundesregierung und dem Bundesrat vorgeschlagen. Die endgültige Berufung erfolgt durch die Präsidentin oder den Präsidenten des Bundestages. Aktuell hat der Deutsche Ethikrat 25 Mitglieder.
Bei seiner Themenwahl gibt es zwei Wege: Zum einen kann die Bundesregierung den Ethikrat offiziell mit der Bearbeitung eines bestimmten Themas beauftragen. Zum anderen kann der Ethikrat auch eigenständig Themen aufgreifen, die er für gesellschaftlich relevant oder ethisch herausfordernd hält.
Über das Klinische Ethikkomitee
Das Klinische Ethikkomitee (KEK) ist ein unabhängiges Gremium aus Mitarbeitenden verschiedener Berufsgruppen am UKW. Es unterstützt die Klinikumsbeschäftigten in Form von Einzel- oder Gruppenberatungen bei moralischen Fragen und Herausforderungen, die sich bei der Versorgung von Patientinnen und Patienten ergeben. Darüber hinaus führt das KEK Fortbildungen zu wichtigen ethischen Themen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums durch. Im Konsens mit den Ansprechpersonen der Kliniken werden Handlungsempfehlungen für häufige ethische Fragen erarbeitet.
Text: Pressestelle / UKW