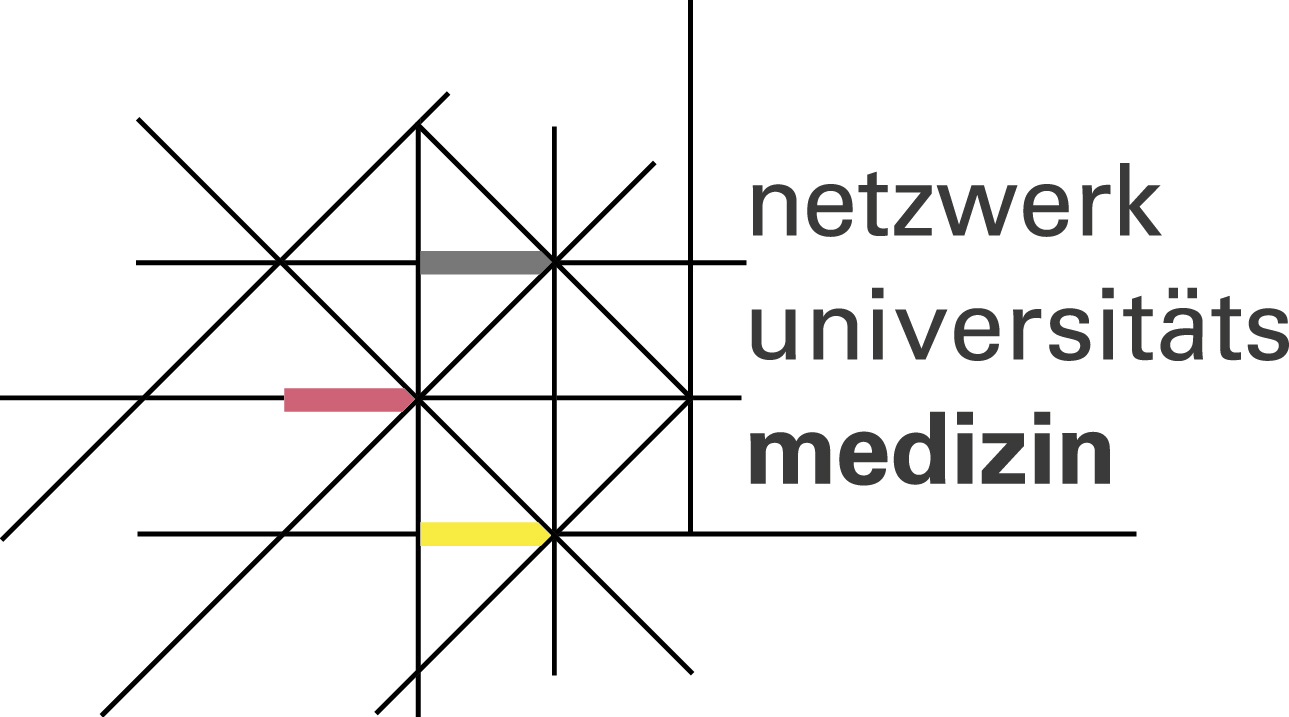Der Forschungsverbund PallPan des Nationalen Forschungsnetzwerks der Universitätsmedizin zu Covid-19, Netzwerk Universitätsmedizin (NUM) besteht aus palliativmedizinischen Einrichtungen von 13 Universitätsklinken und widmet sich den Erfahrungen, Belastungen und Herausforderungen in der Begleitung schwerkranker und sterbender Menschen in der aktuellen Pandemie. In 16 Studien wurden innerhalb von 9 Monaten über 1.700 Betroffene, Versorgende und Verantwortliche im Gesundheitssystem und in der Politik nach ihren Erfahrungen gefragt und deren Aussagen systematisch untersucht und ausgewertet. Auf Basis dieser Ergebnisse und mit Hilfe von 120 Expert*innen aus den verschiedenen Bereichen von Gesundheitswesen, Verwaltung und Politik wurde dann die Nationale Strategie für die Betreuung von schwerkranken und sterbenden Menschen und ihren Angehörigen in Pandemiezeiten entwickelt und konsentiert.
33 Handlungsempfehlungen
Kernstück der Strategie sind 33 konkrete Handlungsempfehlungen, die sich in drei Abschnitte gliedern: Patient*innen & Angehörige unterstützen, Mitarbeitende unterstützen und Strukturen und Angebote der Palliativversorgung unterstützen und aufrechterhalten.
Patient*innen und ihre Angehörigen wünschen sich nach den Befragungsergebnissen vor allem eines für die Zukunft: Nähe am Lebensende auch in einer Pandemie zu ermöglichen. Hierfür braucht es abgewogene Besuchsregelungen für Einrichtungen wie Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, aber auch einen rechtlichen Rahmen, den die Politik schaffen muss. Einzelfallentscheidungen und klar definierte Ausnahmeregelungen haben sich als eine praktikable und hilfreiche Strategie bewährt und sollten überall genutzt werden.
Mitarbeitende in der Versorgung brauchen vor allem ausreichend Schutz vor Infektionen, aber eben auch grundlegende palliativmedizinische Kenntnisse und psychosoziale Unterstützung in herausfordernden Situationen, z.B. auf der Intensivstation oder Pflegeheimen. „Auch in Pandemiezeiten stehen schwerkranken und sterbenden Menschen eine gute Symptombehandlung und würdevolle Begleitung im Einklang mit dem Patientenwillen zu. Das gilt für Infizierte wie für Nicht-Infizierte. Hier brauchen die Versorgenden in der erhöhten Belastung einer Pandemie mehr Unterstützung,“ betont Prof. Dr. Steffen Simon von der Uniklinik Köln und einer der beiden Koordinatoren des PallPan-Verbundes.
Von Seiten der Politik sowie der Kliniken und Pflegeeinrichtungen muss darauf geachtet werden, dass die Palliativversorgungsstrukturen auch und gerade in einer Pandemiesituation aufrecht erhalten bleiben. „Palliativstationen dürfen in einer Pandemie nicht geschlossen werden, vielmehr sollten die ambulanten und stationären palliativmedizinischen Dienste für die notwendige Versorgung von schwerkranken und sterbenden Patient*innen arbeitsfähig bleiben und ggf. angepasst oder sogar erweitert werden, z.B. für Infizierte, die nicht mehr geheilt werden können,“ appelliert Prof. Dr. Claudia Bausewein vom LMU Klinikum München, ebenfalls Koordinatorin des PallPan-Verbundes und Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP).
Link zur PDF: https://doi.org/10.5281/zenodo.5012504
Informationsplattform und Trauerangebote
Nach Veröffentlichung der Handlungsempfehlungen Ende Juni plant der PallPan-Verbund schon weitere Vorhaben: den Aufbau einer webbasierten Informationsplattform, die Entwicklung von Unterstützungsmaterialien für trauernde Angehörige sowie Mitarbeitende in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern, die Integration von PallPan in eine „Nationale Pandemic Preparedness“ für das deutsche Gesundheitswesen sowie die stetige Weiterentwicklung der Handlungsempfehlungen.
Der Forschungsverbund PallPan wird als Teil des Netzwerks Universitätsmedizin (NUM) vom BMBF gefördert. Dem Forschungsverbund gehören die palliativmedizinischen Einrichtungen der Universitätsklinika an den Standorten Aachen, Bonn, Düsseldorf, Erlangen, Freiburg, Göttingen, Hamburg, Hannover, Jena, Köln, München, Rostock und Würzburg an. Die koordinierende Gesamtleitung haben Prof. Dr. med. Claudia Bausewein vom LMU Klinikum München und Prof. Dr. Steffen Simon von der Uniklinik Köln.
Das PallPan-Konsortium lädt zu einer virtuellen Abschlusskonferenz ein, in der die Nationale Strategie vorgestellt wird. (pall.pandemie@ med.uni-muenchen.de )
Termin: 24.06.2021, 14:00 – 17:30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.
Einwahllink (Kenncode: 562238): https://lmu-munich.zoom.us/j/95257337713?pwd=TW5Ib1BnYmNVWFBEMUEvTksrTk95QT09
Kontakt für Journalisten:
Prof. Dr. Claudia Bausewein, LMU Klinikum München, claudia.bausewein@ med.uni-muenchen.de
Prof. Dr. Steffen Simon, Uniklinik Köln, steffen.simon@ uk-koeln.de
Nationales Forschungsnetzwerk der Universitätsmedizin zu Covid-19
Patienten optimal versorgen, Infektionen verhindern, Gesundheitsversorgung erhalten: Die Covid-19-Pandemie bringt Herausforderungen mit sich, die innerhalb kurzer Zeit neue Handlungsstrategien erfordern. Das Nationale Forschungsnetzwerk der Universitätsmedizin zu Covid-19, kurz Netzwerk Universitätsmedizin (NUM), bündelt und stärkt Forschungsaktivitäten zur Bewältigung der aktuellen Lage. Gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, koordiniert durch die Charité – Universitätsmedizin Berlin, arbeitet das Forschungsnetzwerk unter Beteiligung aller deutschen Universitätsklinika und weiterer Netzwerke an Lösungen für eine bestmögliche Patientenversorgung in der Pandemie. 13 umfängliche Verbundprojekte mit Leitungen an den verschiedenen Standorten der Universitätsmedizin sind hierfür konzipiert worden. Das Programm ist auf schnelle, unmittelbare Unterstützungswirkungen ausgerichtet. Ein Akzent liegt auf der kliniknahen Forschung und Versorgungsforschung, deren Ergebnisse gemäß dem translationalen Ansatz direkt in Versorgung und Krisenmanagement einfließen. Dem Forschungsnetzwerk und den beteiligten Einrichtungen stehen zur Umsetzung dieser Aufgabe rund 150 Millionen Euro im ersten Jahr bereit, ab 2021 soll das Netzwerk bis zum Jahr 2024 mit weiteren 80 Millionen Euro jährlich bzw. zusätzlichen 240 Millionen Euro gefördert werden. Die gemeinsamen Entwicklungen in Forschung und Patientenversorgung, evidenzbasiertes Vorgehen sowie gegenseitiges Lernen sollen zu einem gemeinsamen Vorgehen bei der Pandemiebekämpfung und einer „Pandemic Preparedness“ führen. Weitere Informationen: www.netzwerk-universitaetsmedizin.de
Pressemitteilung herunterladen