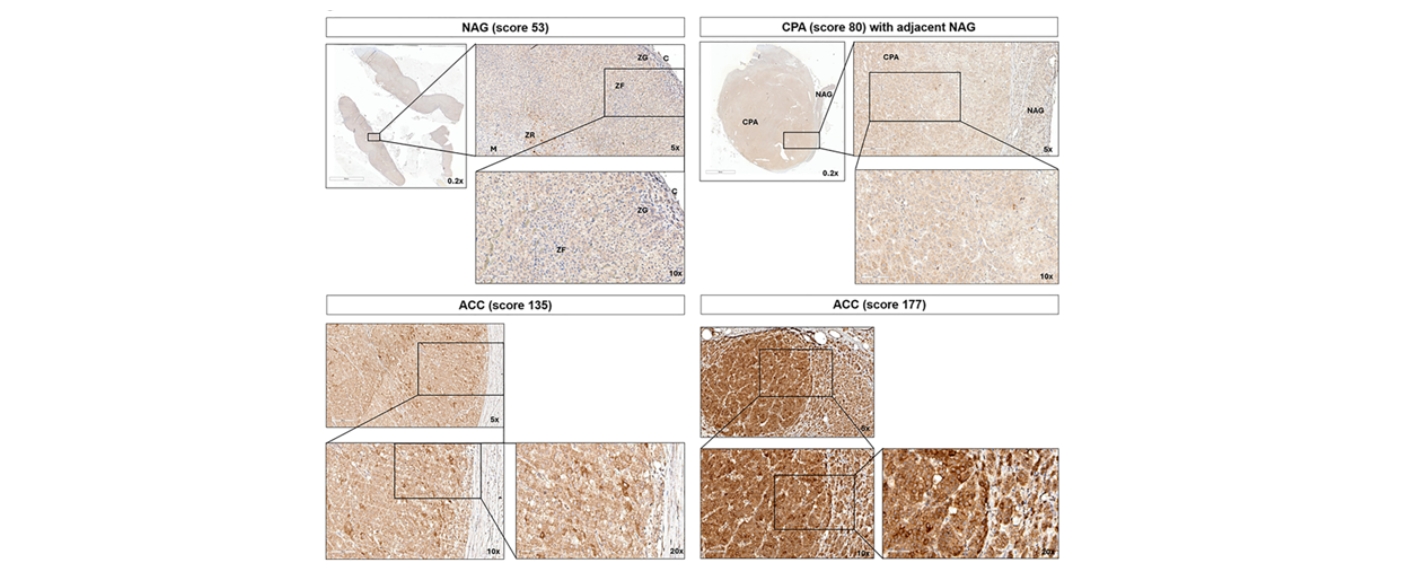Das Phäochromozytom und das Paragangliom sind gutartige Wucherungen in der Nebennierenrinde bzw. in den Nebennierenmark-Zellen. Diese Tumoren produzieren häufig Hormone, die den Blutdruck stark steigern, und sind schwierig zu kontrollieren, wenn sie sich bereits ausgebreitet haben. Die meisten Fälle von metastasiertem Phäochromozytom und Paragangliom werden durch eine Fehlregulation des Hypoxie-induzierbaren Faktors 2α (HIF-2α) verursacht. Belzutifan kann bei Patienten mit bestimmten Blutkrankheiten die Wirkung von Tumoren verringern.
Die Ergebnisse zeigen, dass rund ein Viertel der insgesamt 72 Patientinnen und Patienten, die an der Studie teilnahmen, eine deutliche Tumorverkleinerung erlebte und 85 % der Teilnehmenden zumindest ein dauerhaftes Stillstehen der Krankheit erreichten – also ohne Fortschreiten über längere Zeit stabil blieben. Die mediane Ansprechdauer betrug 20,4 Monate mit einer medianen progressionsfreien Überlebensdauer von 22,3 Monaten. Nach zwei Jahren lebten noch etwa 76 % der Teilnehmenden.
Ein weiterer interessanter Befund war, dass bei einem Drittel derjenigen, die Bluthochdruckmedikamente benötigten, die Dosis nach Beginn der Behandlung deutlich reduziert werden konnte – ein Hinweis darauf, dass Belzutifan auch den hormonellen Einfluss der Tumoren günstig beeinflusst.
Nebenwirkungen traten häufig auf – fast alle Teilnehmenden (11%) berichteten über unerwünschte Effekte. Acht Teilnehmer hatten behandlungsbedingte schwerwiegende Nebenwirkungen. Allerdings sind diese Nebenwirkungen im Vergleich zu anderen Medikamenten, die für das metastasierte Phäochromozytom eingesetzt werden, eher weniger beeinträchtigend.
Insgesamt deutet diese Studie darauf hin, dass Belzutifan eine wirksame und dauerhafte Behandlungsoption für Menschen mit fortgeschrittenem Phäochromozytom oder Paragangliom sein kann, für die es bislang nur begrenzt wirksame Therapien gab.
Publikation
Camilo Jimenez, Mikkel Andreassen, Alice Durand, Sophie Moog, Andrew Hendifar, Staffan Welin, Francesca Spada, Rohini Sharma, Edward Wolin, Joseph Ruether, Rocio Garcia-Carbonero, Martin Fassnacht, Jaume Capdevila, Jaydira Del Rivero, Othon Iliopoulos, Olivier Huillard, Raymond Jang, Knut Mai, Elena Artamonova, Andreas Hallqvist, Tobias Else, Amos Odeleye-Ajakaye, Alexander Gozman, Girish S Naik, Alfredo Berruti 26; LITESPARK-015 Investigators. Belzutifan for Advanced Pheochromocytoma or Paraganglioma. N Engl J Med. 2025 Nov 20;393(20):2012-2022. doi: 10.1056/NEJMoa2504964. Epub 2025 Oct 18. PMID: 41124218.
Zur Publikation