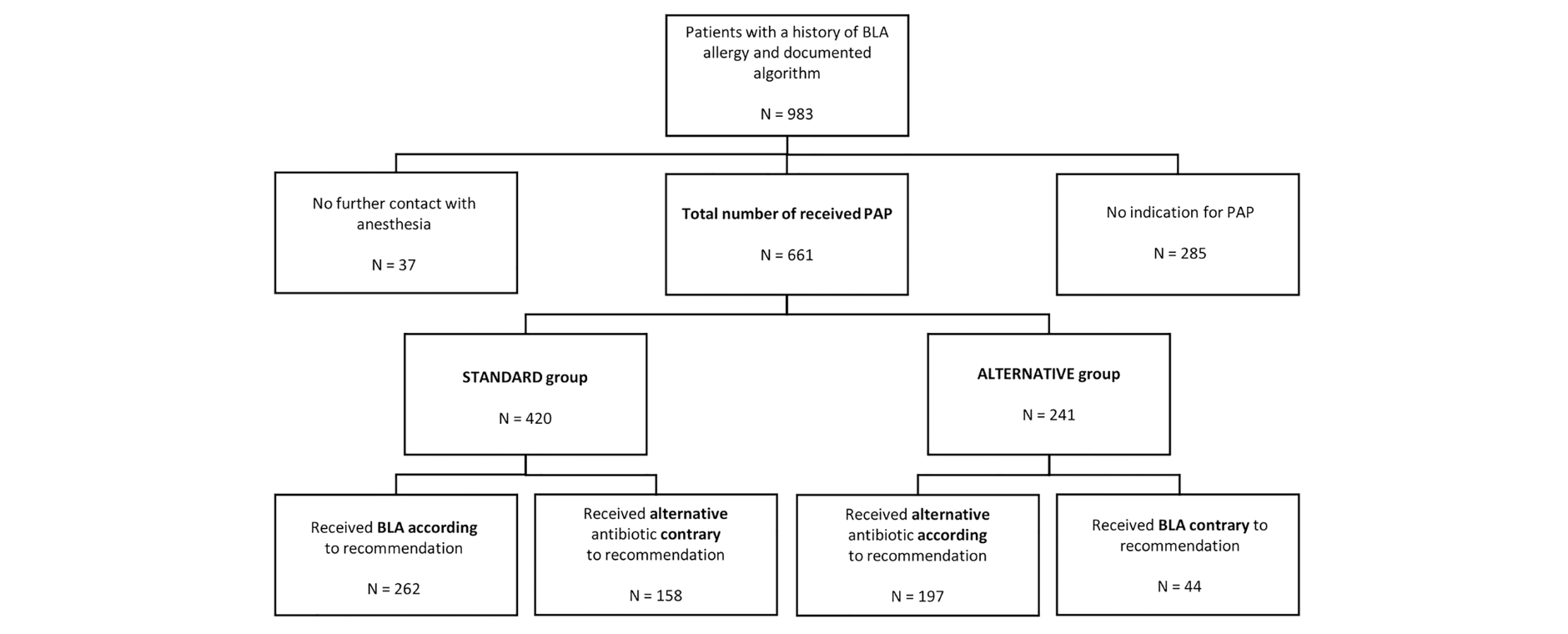Eine aktuelle systematische Übersichtsarbeit unter Leitung des Universitätsklinikums Würzburg (UKW) im Rahmen des vom Netzwerk Universitätsmedizin (NUM) geförderten Projekts UTN (Universitäres Telemedizin-Netzwerk) zeigt: Telemedizin auf Intensivstationen hat zwar ein erhebliches Potenzial, doch die wissenschaftliche Evidenz für konkrete patientenrelevante Vorteile ist bislang nicht eindeutig belegt
In der in PLOS Digital Health veröffentlichten Übersichtsarbeit wurden 26 kontrollierte Studien mit über zwei Millionen intensivmedizinischen Fällen analysiert. Dabei zeigte sich, dass die vorhandenen Studien hinsichtlich Methodik, untersuchter Modelle und Messgrößen sehr unterschiedlich sind, sodass eine quantitative Zusammenfassung (Meta-Analyse) nicht möglich war. Wichtige Fragen – etwa zu Auswirkungen auf Sterblichkeit, Aufenthaltsdauer oder Lebensqualität – bleiben daher offen.
Die Autorinnen und Autoren betonen, dass nicht nur die technische Umsetzung, sondern vor allem methodisch hochwertige, patientenzentrierte Studien benötigt werden, um den wirklichen Nutzen der Tele-Intensivmedizin zu klären und die effektivsten Modelle zu identifizieren.
Weitere Informationen, auch zur Expertise in Tele-Intensivmedizin der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie liefert die Pressemeldung.
Publikation
Tamara Pscheidl, Carina Benstoem, Kelly Ansems, Lena Saal-Bauernschubert, Anne Ritter, Ana-Mihaela Zorger, Karolina Dahms, Sandra Dohmen, Eva Steinfeld, Julia Dormann, Claire Iannizzi, Nicole Skoetz, Heidrun Janka, Maria-Inti Metzendorf, Carla Nau, Miriam Stegemann, Patrick Meybohm, Falk von Dincklage, Sven Laudi, Falk Fichtner, Stephanie Weibel. Telemedicine in adult intensive care: A systematic review of patient-relevant outcomes and methodological considerations. PLOS Digit Health. 2025 Dec 15;4(12):e0001126. https://doi.org/10.1371/journal.pdig.0001126