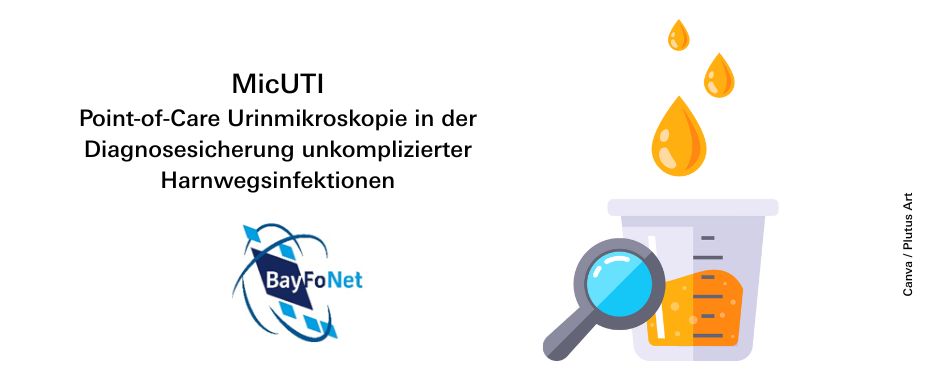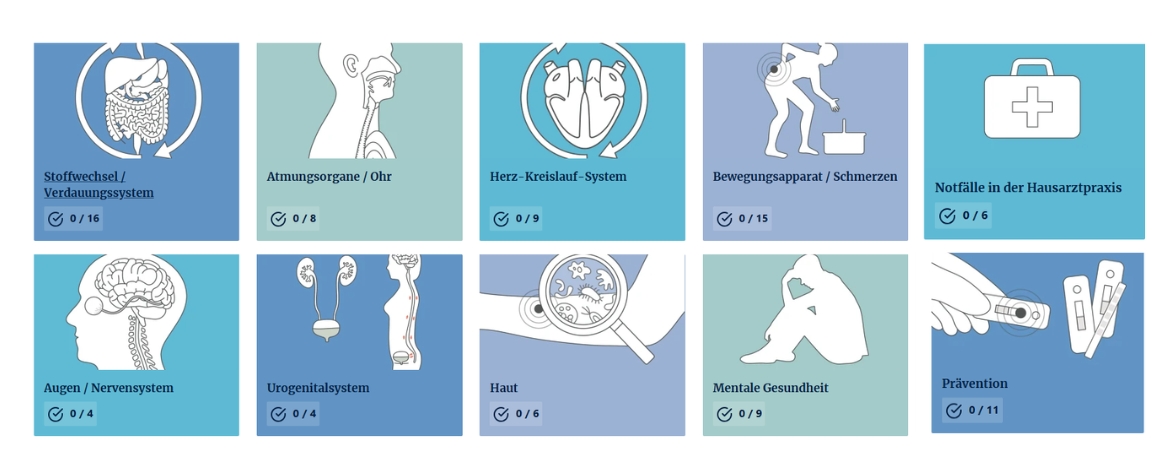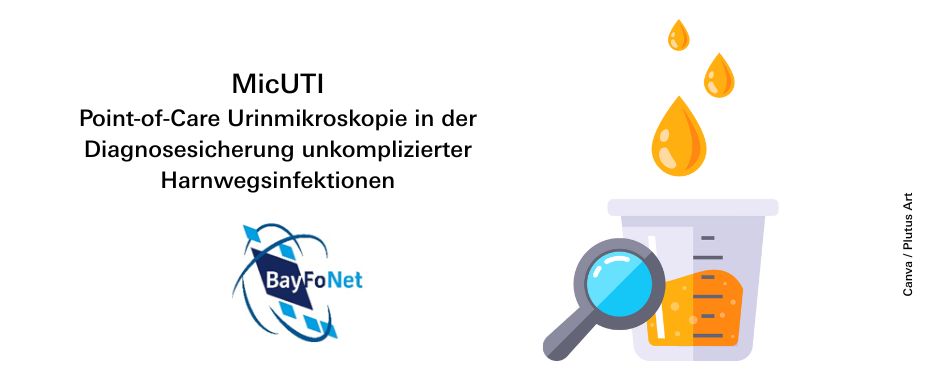
In der vom BMFTR geförderten MicUTI-Studie wurde nun die Durchführbarkeit einer neuartigen Point-of-Care-Test-(POCT)-Strategie bei unkomplizierten Harnwegsinfektionen untersucht. Dabei wurde getestet, ob mithilfe von Urinteststreifen und einer mikroskopischen Untersuchung des Urins (Phasenkontrastmikroskopie) die Diagnose einer Harnwegsinfektion unmittelbar in der Praxis verbessert und eine gezielte Therapieentscheidung getroffen werden kann. An der randomisiert-kontrollierten Pilotstudie beteiligten sich über das Bayerische Forschungsnetz in der Allgemeinmedizin (BayFoNet) 20 Hausarztpraxen.
Insgesamt wurden 157 Patientinnen rekrutiert: 90 in der Interventionsgruppe mit POCT-Strategie und 67 im Kontrollarm mit üblicher Versorgung. Der Antibiotikaeinsatz blieb in beiden Gruppen nahezu identisch. Die diagnostische Aussagekraft der Mikroskopie war nicht sehr zuverlässig, insbesondere wenn es darum ging, eine Infektion sicher auszuschließen (von allen mikroskopisch negativ getesteten Proben erwiesen sich dennoch 54 % der Urinproben als infiziert). Die Umsetzung im Praxisalltag erwies sich dennoch als machbar: Die telefonische Nachbeobachtung bis Tag 28 gelang bei 75 % der Teilnehmerinnen.
MicUTI zeigt, dass zusätzliche Diagnostik allein nicht ausreicht, um die Verschreibung von Antibiotika zu senken. Explorative Analysen deuten vielmehr darauf hin, dass mehr verfügbare Testergebnisse ohne angepasste Algorithmen die Verordnung von Antibiotika sogar erhöhen könnten. Das heißt, Hausärzte hätten möglicherweise eher mehr Antibiotika verschrieben, wenn sie die Laborergebnisse der Urinkultur sofort vor Ort gehabt hätten. Diese Ergebnisse bilden die Grundlage für die Planung einer Folgestudie, in der weiterentwickelte Entscheidungsalgorithmen mit neuen POCT zum Einsatz kommen sollen.
Publikation: Peter K. Kurotschka, Martin J. Koch, Eva Bucher, Adolfo Figueiras, Jochen Gensichen, Alexander Hapfelmeier, Alastair D. Hay, Christian Kretzschmann, Oliver Kurzai, Thiên-Trí Lâm, Kathrin Lasher, Orietta Massidda, Linda Sanftenberg, Guido Schmiemann, Antonius Schneider, Anne Simmenroth, Stefanie Stark, Lisette Warkentin, Mark H. Ebell, Ildikó Gágyor, on behalf of the Bavarian Practice-Based Research Network (BayFoNet). Dipsticks and point-of-care Microscopy in Urinary Tract Infections in primary care: Results of the MicUTI pilot cluster randomised controlled trial. PLOS One. October 8, 2025. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0332390