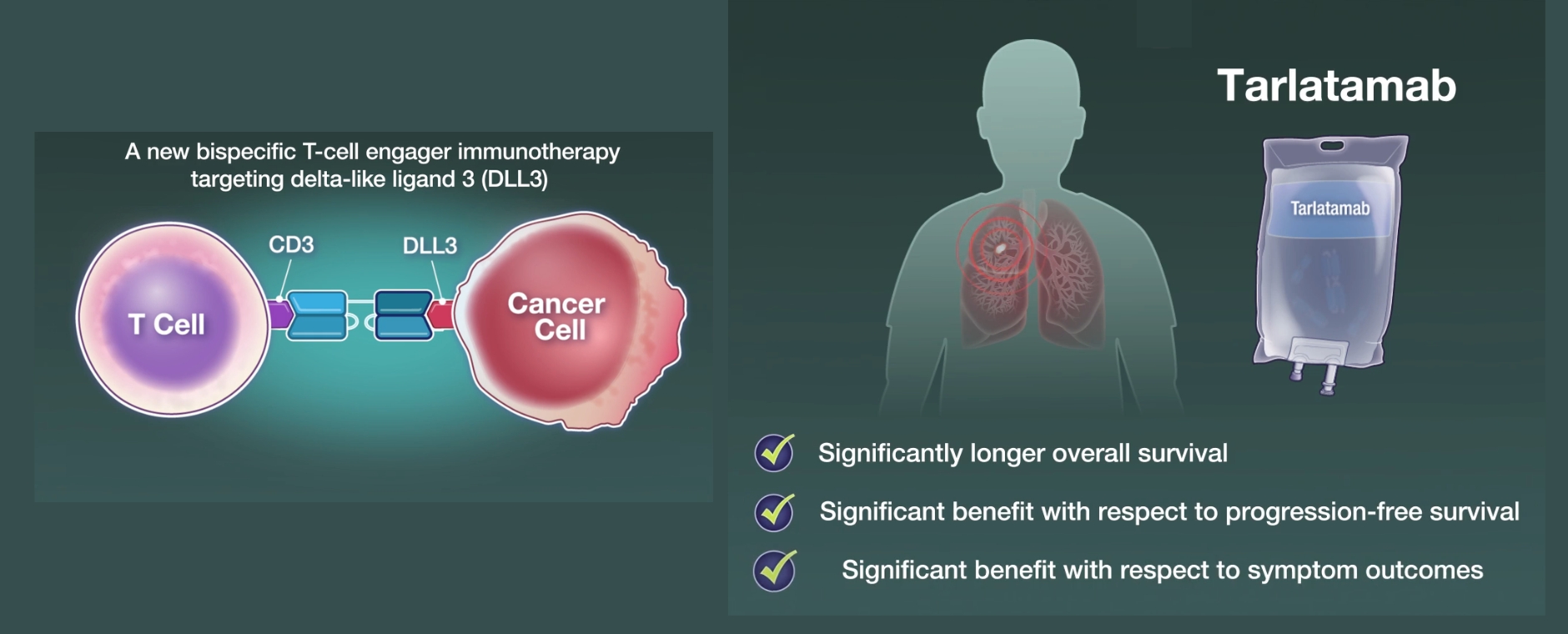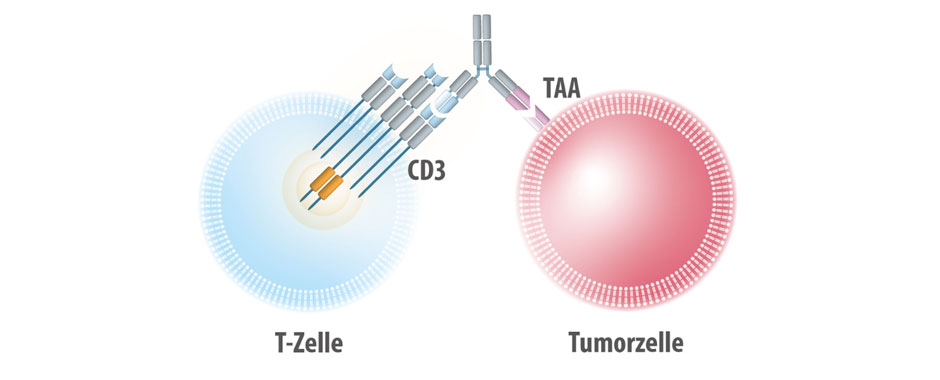Dort wurde ein Patient mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs vorgestellt, der zusätzlich zur bereits bekannten, behandelbaren Mutation des EGFR-Gens eine CTNNB1-Mutation (β-Catenin) aufwies. Diese CTNNB1-Mutation wurde bisher eher mit schlechteren Krankheitsverläufen in Verbindung gebracht. Überraschenderweise blieb der Patient unter seiner laufenden Therapie über einen langen Zeitraum stabil. Gemeinsam mit Dr. Horst-Dieter Hummel, dem Leiter des Würzburger Standorts im nationalen Netzwerk Genomische Medizin (nNGM), und Jonas Kulhavy, einem Naturwissenschaftler im nNGM-Team, ging Vivek Venkataramani dieser Beobachtung systematisch nach. Die Ergebnisse ihrer Analyse wurde im Journal of Clinical Oncology (JCO) Precision Oncology, einer der führenden internationalen Fachzeitschriften für personalisierte Krebsmedizin, veröffentlicht.
Nicht-kleinzelliger Lungenkrebs (englisch non-small cell lung cancer, NSCLC) ist die häufigste Form von Lungenkrebs. Etwa 80–85 % aller Lungenkrebsfälle gehören zu dieser Gruppe. Eine der bekanntesten genetischen Veränderungen beim NSCLC ist die sogenannte EGFR-Mutation. EGFR steht für „Epidermal Growth Factor Receptor“ und wirkt wie ein Gaspedal für das Zellwachstum. Es wird normalerweise nur dann betätigt, wenn neue Zellen benötigt werden, beispielsweise bei der Wundheilung. Durch die Mutation ist das Pedal jedoch dauerhaft „durchgedrückt“, sodass sich Zellen unkontrolliert vermehren und das Krebswachstum beschleunigt wird. Weil dieser sogenannte onkogene Treiber so klar identifizierbar ist, gibt es moderne Medikamente, die gezielt eingreifen und das Wachstum bremsen.
Kommt jedoch eine weitere Mutation des β-Catenin-Gens (CTNNB1), das das Zellwachstum steuert, hinzu, galt das bislang als schlechtes Omen. Viele Fachleute nahmen an, dass zwei aktivierte Wachstumsmotoren den Tumor aggressiver und schwerer behandelbar machen. Die neue Analyse zeigt jedoch das Gegenteil: Gerade dieses Zusammenspiel scheint die Wirkung der EGFR-gerichteten Medikamente zu verstärken und sorgt dafür, dass Betroffene eine günstigere Prognose haben.
Vivek Venkataramani, Horst Hummel und Jonas Kulhavy, der Erstautor der Studie, analysierten zunächst die genetischen Daten von 1.804 Patientinnen und Patienten mit NSCLC am UKW. Dabei identifizierten sie 15 weitere Betroffene mit der gleichen Doppelmutation. „Die Konstellation war zwar selten, aber die klinische Beobachtung zu auffällig, um sie zu ignorieren“, betont Hummel. Da die Zahl der Fälle in Würzburg allein nicht ausreichte, wurde die Thoraxklinik Heidelberg hinzugezogen, ein Partnerstandort im nNGM-Verbund unter der Leitung von Prof. Dr. Petros Christopoulos. Dort wurden elf weitere Fälle identifiziert. Durch die Zusammenführung der Daten entstand die weltweit größte dokumentierte Fallserie zu dieser Mutationskonstellation beim nicht-kleinzelligen Lungenkrebs.
Die Ergebnisse sind eindeutig: Menschen mit NSCLC und beiden Genveränderungen lebten nicht nur länger, sondern ihre Krankheit blieb auch deutlich länger stabil. Im Durchschnitt vergingen fast vier Jahre (44,5 Monate), bis die Erkrankung erneut fortschritt – mehr als doppelt so lange wie bei Patientinnen und Patienten mit nur einer EGFR-Mutation (15,2 Monate). Auch die Lebenserwartung war deutlich erhöht: Während die mittlere Überlebenszeit in der Vergleichsgruppe bei gut zwei Jahren (24,5 Monate) lag, war sie in der CTNNB1-Gruppe zum Zeitpunkt der Analyse noch nicht erreicht– ein starkes Zeichen für einen anhaltenden Behandlungserfolg. Selbst nach Berücksichtigung anderer Faktoren wie Alter, Immunstatus oder zusätzlicher Genveränderungen blieb dieser Überlebensvorteil bestehen. Weitere molekulare Analysen untermauern das Bild einer biologisch günstigeren Tumorform: Tumoren mit dieser Doppelmutation wiesen seltener zusätzliche Risikofaktoren wie TP53-Mutationen oder MET-Amplifikationen auf, die häufig mit einem aggressiveren Verlauf und Therapieresistenz verbunden sind. TP53-Mutationen sind Fehler im Wächter-Gen, das normalerweise Krebszellen stoppt, bei MET-Amplifikationen handelt es sich um zu viele Kopien eines anderen Wachstumsrezeptors.
„Unsere Ergebnisse zeigen, dass nicht jede zusätzliche Genveränderung ein schlechtes Omen ist“, so Venkataramani. „Gerade diese Doppelmutation könnte künftig helfen, das Risiko von Patientinnen und Patienten genauer einzuschätzen und Behandlungen noch individueller zu gestalten. Das zeigt, wie wichtig molekulare Tumorboards sind, um solche Muster zu erkennen und gezielt zu nutzen.“
Die Forschenden weisen jedoch darauf hin, dass es sich um eine rückblickende Analyse handelt. „Unsere Daten liefern eine starke Hypothese“, so Kulhavy. „Jetzt müssen größere, vorausschauende Studien zeigen, ob sich diese Erkenntnisse auch in anderen Patientengruppen bestätigen lassen.“
Jonas Kulhavy, Katja Maurus, Miriam Blasi, Stephanie Brändlein, Simone Reu-Hofer, Julia Doll, Julia Böck, Albrecht Stenzinger, Daniel Kazdal, Jan Budczies, Valeria Roll, Volker Kunzmann, Elena Gerhard-Hartmann, Andreas Rosenwald, Ralf Bargou, Maria-Elisabeth Goebeler, Jens Kern, Pius Jung , Markus Krebs, Manik Chatterjee, Petros Christopoulos, Vivek Venkataramani, Horst-Dieter Hummel. Impact of Baseline β-Catenin Comutations on Prognosis in EGFR-Mutant Lung Cancer. JCO Precis Oncol 9, e2400771(2025). https://doi.org/10.1200/PO-24-00771