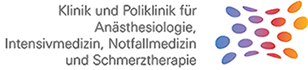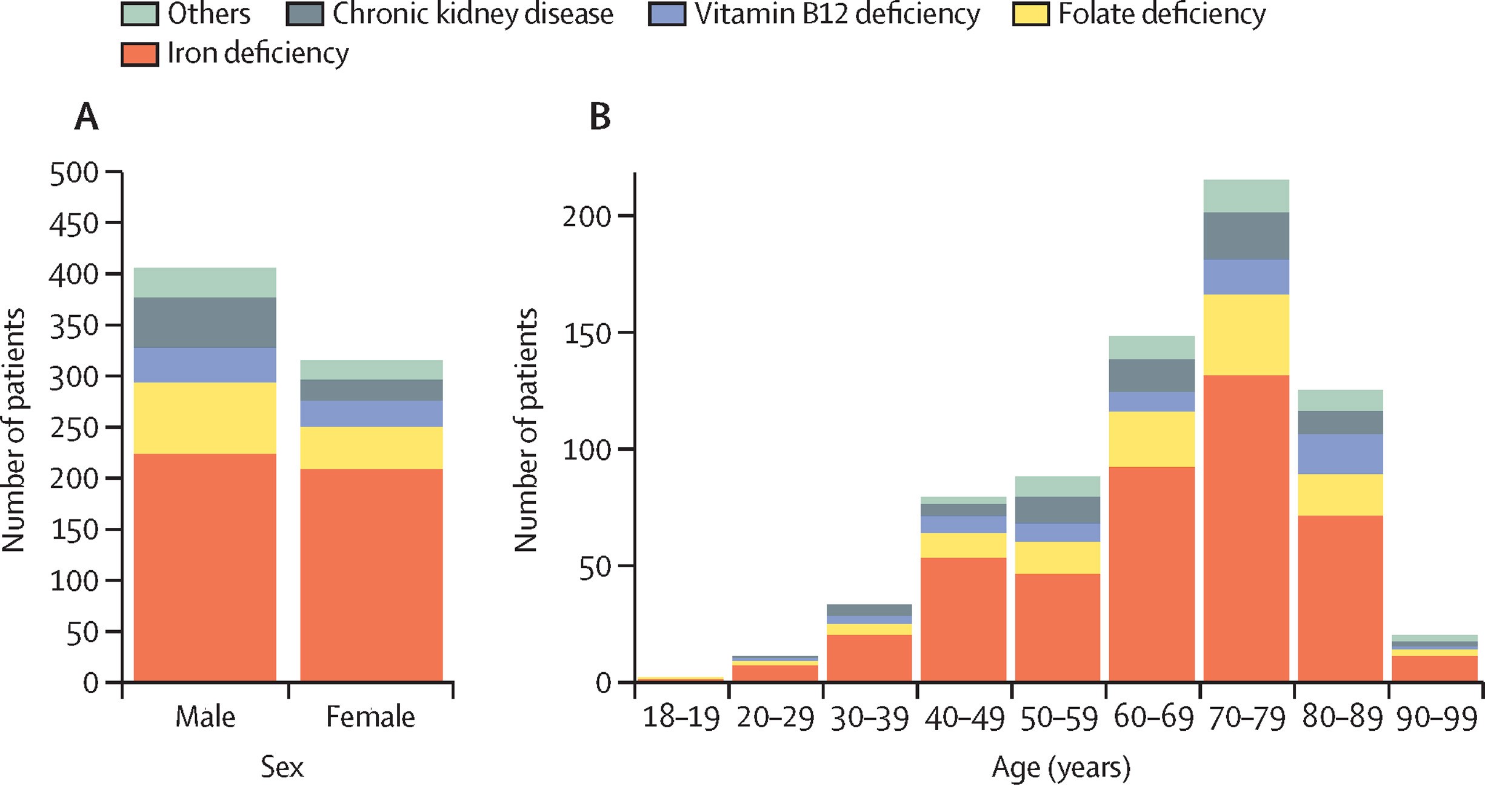Die Entschlüsselung der molekularen Identität von schlafenden Nozizeptoren, an der Professorin Barbara Namer vom Uniklinikum Würzburg maßgeblich beteiligt war, bringt die Entwicklung besserer Therapien gegen chronische Nervenschmerzen einen wichtigen Schritt voran.
Würzburg. Ob heißer Kochtopf, spitze Nadel oder zufallende Tür – sobald wir potenziellen Gefahren zu nahe kommen, schlagen Schmerzrezeptoren, sogenannte Nozizeptoren, in unserem Körper Alarm, um uns zu schützen. Nach ihrer Aktivierung senden die Alarmsensoren elektrische Signale ans Rückenmark und Gehirn, wo der Schmerz wahrgenommen wird. Es gibt schnelle Nozizeptoren für akute, stechende Schmerzen und langsamere für dumpfe, anhaltende Schmerzen. Zu letzteren gehören die sogenannten „schlafenden Nozizeptoren“.
Diese reagieren in gesundem Gewebe nicht auf physikalische Reize, also weder auf Druck noch auf Nadelstiche. Sie werden jedoch durch chemische Verbindungen wie Toxine aber auch körpereigene Substanzen stark aktiviert, was zu Schmerzen führt. Bei länger anhaltenden krankhaften Zuständen, etwa bei Entzündungen oder Nervenschäden, werden diese ursprünglich schlafenden Schmerzsensoren sensibler. Dann können sie plötzlich auch auf Druck reagieren, was dazu führt, dass solche Reize als deutlich schmerzhafter wahrgenommen werden. Bei Patientinnen und Patienten mit Nervenschmerz können diese Sensoren spontan aktiv werden und dauerhaft Signale abgeben, ohne dass dafür ein offensichtlicher Grund besteht. Diese spontane Aktivität gilt bislang als der einzige objektiv messbare Hinweis darauf, dass periphere Nerven dauerhaft an der Entstehung von Nervenschmerzen beteiligt sind. Damit sind schlafende Nozizeptoren beim Menschen weder verschlafen noch inaktiv, sondern klinisch relevante wichtige Spieler beim chronischen Schmerz.
Eine die seit Jahrzehnten an diesen schlafenden Nozizeptoren forscht ist Professorin Dr. med. Barbara Namer aus der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie des Uniklinikums Würzburg (UKW). Die Medizinerin leitet am Zentrum für interdisziplinäre Schmerzmedizin (ZiS) in der klinischen Forschungsgruppe KFO 5001 ResolvePAIN die Arbeitsgruppe „Neuronale Signalwege von Schmerz und Juckreiz beim Menschen“. Außerdem betreut sie noch ein Labor an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen (FAU), wo einst ihre Faszination an den schlafenden Nozizeptoren geweckt wurde. Das dortige Institut für Physiologie und Pathophysiologie mit Prof. Hermann Handwerker und Dr. Martin Schmelz trug in Kooperation mit dem Institut für Neurophysiologie in Uppsala, Schweden, mit Dr. Roland Schmidt und Prof. Erik Torebjörk in den 1990er Jahren maßgeblich zur Entdeckung und Beschreibung der schlafenden Nozizeptoren beim Menschen bei.
Jeder Zehnte leider an neuropathischen Schmerzen
Obwohl die funktionellen Eigenschaften dieser Neuronen seit vielen Jahren bekannt sind, blieb ihre molekulare Identität bislang unklar. Damit fehlte eine entscheidende Voraussetzung für das Verständnis von chronischem Schmerz und die Entwicklung gezielter therapeutischer Interventionen. Der Bedarf ist groß. Schließlich leiden etwa zehn Prozent der Bevölkerung an neuropathischen Schmerzen.
Ein multiprofessionelles Team entschlüsselte nun die molekulare Signatur der schlafenden Nozizeptoren. Die Arbeit demonstriert eindrucksvoll die Stärke intensiver interdisziplinärer und internationaler Kooperation. Der Erfolg der Studie beruht auf der engen Zusammenarbeit hochspezialisierter Zentren mit Expertise in „Patch-seq“, der zellulären Elektrophysiologie mittels Patch-Clamp-Techniken in Kombination mit Einzelzell-RNA-Sequenzierung unter der Führung von Prof. Angelika Lampert, Direktorin des Instituts für Neurophysiologie an der Uniklinik RWTH Aachen, sowie Bioinformatik im kanadischen Toronto unter der Leitung von Dr. Shreejoy Tripathy am Krembil Centre for Neuroinformatics des Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) der University of Toronto, und translationaler Kompetenz bei der Übertragung molekularer Erkenntnisse auf den Menschen mithilfe der elektrophysiologischen Technik der Mikroneurographie, die Barbara Namer maßgeblich verantwortete. Die Ergebnisse wurden in der renommierten Fachzeitschrift Cell veröffentlicht.
Molekulares Profil mit Rezeptor OSMR, Neuropeptid SST und Ionenkanal Nav1 1.9
Zunächst wurde die molekulare Identität sensorischer Neurone von Schweinen untersucht. Diese Neurone sitzen im sogenannten „Spinalganglion“, das neben der Wirbelsäule liegt. Beim lebenden Menschen kann es nicht entfernt und somit nicht untersucht werden. Und im Gegensatz zu Mäusen besitzen Schweine schlafende Nozizeptoren in der Haut, die denen des Menschen sehr ähnlich sind. Die vergleichend am Menschen (Barbara Namer) und am Schwein (Prof. Martin Schmelz, Uniklinikum Mannheim) gewonnenen Einsichten über die biophysikalischen Eigenschaften schlafender Nozizeptoren wurden in zelluläre Patch-Clamp-Experimente übersetzt.
Mithilfe dieser Patch-Clamp-Untersuchungen wurde in Aachen die elektrische Aktivität einzelner Neurone in vitro aufgezeichnet und anhand der biophysikalischen Eigenschaften potentielle schlafende Nozizeptoren identifiziert. Die so charakterisierten Zellen wurden nachfolgend mit Einzelzell-Gensequenzierung untersucht. Anschließend wurden die Daten mit umfassenden bioinformatischen Analysen zusammengeführt.
Die Analysen des internationalen Teams zeigen, dass schlafende Nozizeptoren durch eine spezifische molekulare Signatur definiert sind. Zu dieser Signatur gehören unter anderem der Oncostatin-M-Rezeptor (OSMR) und das Neuropeptid Somatostatin (SST). Die Ergebnisse weisen zudem auf weitere pharmakologische Zielstrukturen hin, darunter der Ionenkanal Nav1.9. Dieser ist in schlafenden Nozizeptoren stark exprimiert und trägt zu deren charakteristischen elektrischen Eigenschaften bei. Durch die gezielte Beeinflussung von Nav1.9 spezifisch in Nozizeptoren könnte es möglich werden, Medikamente zu entwickeln, die die schmerzauslösende Überaktivität dieser Neurone selektiv beruhigen.
Humane Mikroneurographie-Messungen bestätigten bioinformatische Analysen
Diese molekularen Vorhersagen mussten schließlich am Menschen validiert werden. Barbara Namer, die sich der translationalen Forschung, also der Übertragung von Grundlagenforschung in die klinische Forschung, verschrieben hat, verantwortete die humanen Mikroneurographie-Messungen. Bei dieser technisch anspruchsvollen Methode wird die Aktivität einzelner Nozizeptoren direkt in der menschlichen Haut gemessen. Damit konnte gezeigt werden, dass Oncostatin M schlafende Nozizeptoren in der menschlichen Haut spezifisch moduliert und damit die bioinformatischen Analysen bestätigt werden.
„30 Jahre lang haben wir von Markern für schlafende Nozizeptoren geträumt. Nun konnten wir unseren Traum Wirklichkeit werden lassen und damit den Zugang zu einer ganz neuen Welt eröffnen“, freut sich Barbara Namer, die sich mit Lampert und Tripathy die Letztautorenschaft teilt. Sie nahm das Forschungsgebiet der unterschiedlichen Nozizeptorenklassen des Menschen und insbesondere die Wichtigkeit der schlafenden Nozizeptoren einst mit nach Aachen und freute sich, in der dortigen Forschungsumgebung dazu beizutragen deren molekulare Identität zu entschlüsseln. „Jetzt, da wir die schlafenden Nozizeptoren auf molekularer Ebene kennen, können wir in verschiedenen Geweben gezielt nach diesen Neuronen suchen. Bei Schmerzpatienten können wir genau diese Neuronen untersuchen, die wir für den Schlüssel zum chronischen Schmerz in der Peripherie halten. Dies ist der erste wichtige Schritt um Ansatzpunkte für neue Medikamente finden, die diese schmerzverursachenden Zellen beruhigen“, erläutert sie. Weitere Forschungsprojekte zum Thema „schlafende Nozizeptoren“ sind in Würzburg in Planung. Am UKW gibt es eine starke Expertise zum chronischen Schmerz innerhalb der Forschungsgruppe KFO5001 ResolvePain sowie die Möglichkeit, Neuronen in menschlicher Haut anzufärben.
Publikation: Jannis Körner*, Derek Howard*, Hans Jürgen Solinski, Marisol Mancilla Moreno, Natja Haag, Andrea Fiebig, Anna Maxion, Shamsuddin A. Bhuiyan, Idil Toklucu, Raya A. Bott, Ishwarya Sankaranarayanan, Diana Tavares-Ferreira, Stephanie Shiers, Nikhil N. Inturi, Esther Eberhardt, Lisa Ernst, Lorenzo Bonaguro, Jonas Schulte-Schrepping, Marc D. Beyer, Thomas Stiehl, William Renthal,Ingo Kurth, Jenny Tigerholm, Jordi Serra, Theodore Price, Martin Schmelz, Barbara Namer*, Shreejoy Tripathy*, and Angelika Lampert*. Molecular architecture of human dermal sleeping nociceptors. Cell (2026), https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.12.048
*geteilte Erst- und Letztautorenschaft
Text: KL / Wissenschaftskommunikation UKW