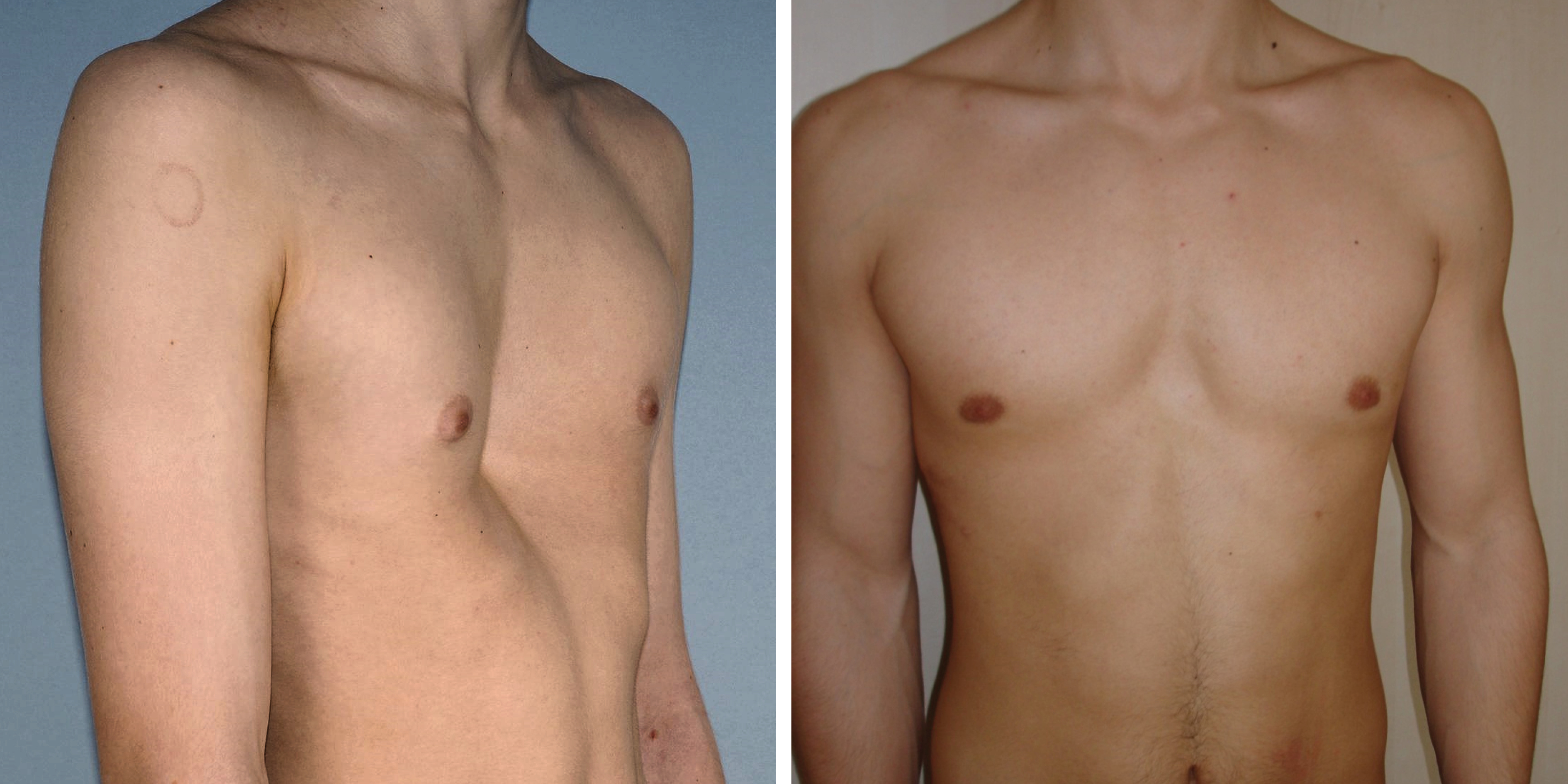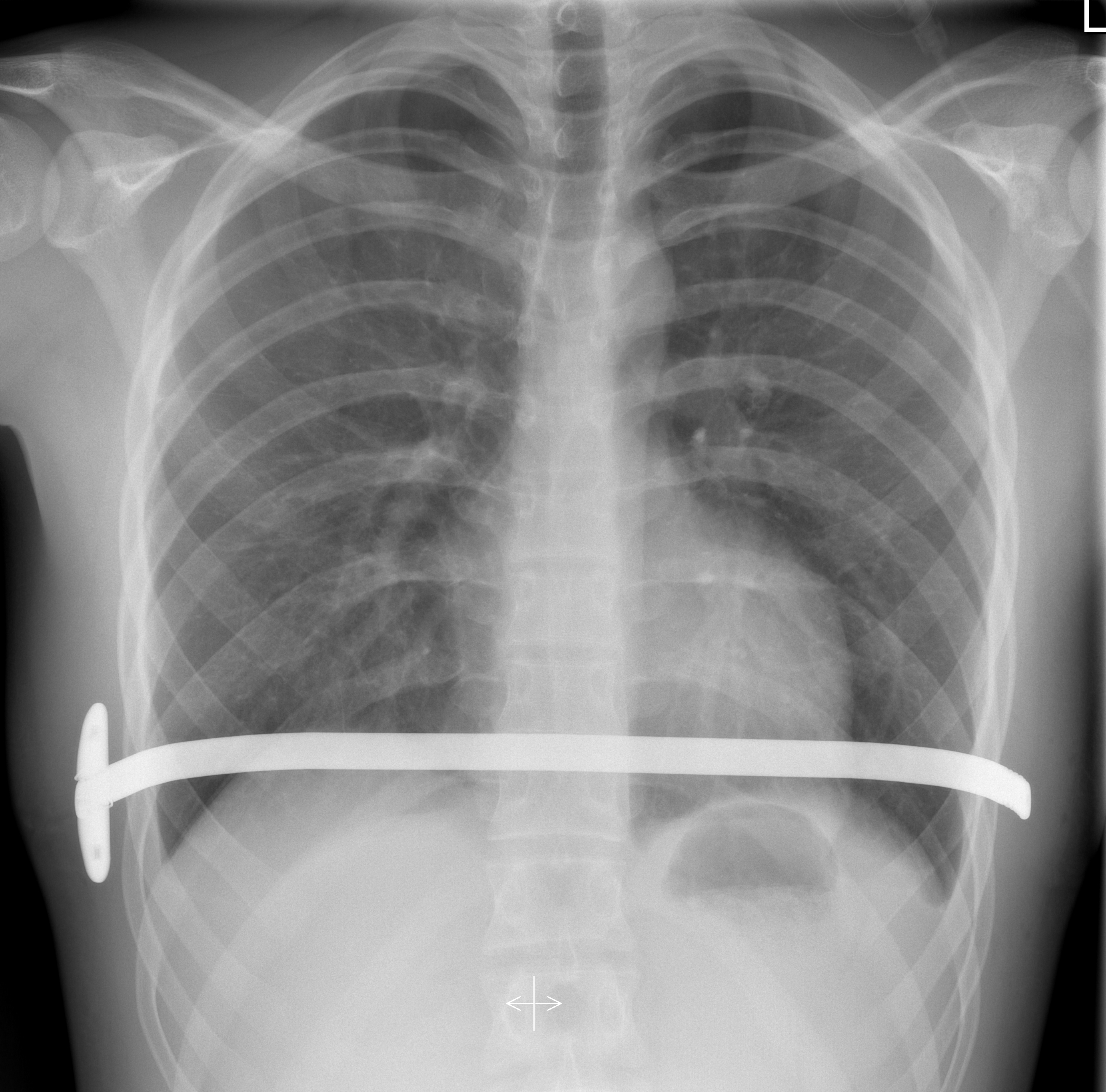Er ist ein akademischer Chirurg mit translationaler Ausrichtung. Sein Schwerpunkt sei unheimlich schön, weil inhaltlich hochspannend und innovativ, interdisziplinär, operationstaktisch extrem herausfordernd und sehr nah am Patienten, sagt er. Der Universitäts-Professor Dr. Florian Seyfried leitet die Chirurgie des oberen Gastrointestinaltrakts und bariatrische Chirurgie am Universitätsklinikum Würzburg und hat vor kurzem die neu eingerichtete gleichnamige Professur an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg erhalten. Das heißt: Florian Seyfried erforscht, lehrt, behandelt und operiert starkes Übergewicht sowie Funktionsstörungen der Speiseröhre und des Magens und bösartige Tumoren im oberen Verdauungstrakt. Gaster heißt auf griechisch Magen, intestinum auf lateinisch Darm. Der Gastrointestinaltrakt umfasst also die vom Mund bis zum Darmausgang reichende Röhre. Seyfried konzentriert sich auf den oberen Bereich: Speiseröhre, Magen und Dünndarm.
Speiseröhre und Magen gehören in vielerlei Hinsicht zusammen
Der gebürtigen Wormser war schon früh im Studium in Würzburg fasziniert von der Atmosphäre im Operationsaal, der chirurgischen Herangehensweise an Probleme, den Herausforderungen, Krankheitsbilder zu verstehen und Verantwortung zu übernehmen. Vor allem Menschen mit starkem Übergewicht oder Schluckbeschwerden hätten einen hohen Leidensdruck, da sei es sehr bewegend, wenn man ihnen helfen könne. Die metabolische bariatrische Chirurgie wurde früh sein Forschungsschwerpunkt – metabolisch, weil die gewichtsreduzierende Operation (bariatrisch = medizinisch Behandlung des Übergewichts) zu einer maßgeblichen Verbesserung des Stoffwechsels (Metabolismus) führen kann. Seyfried habilitierte auf diesem Gebiet, führte preisgekrönte grundlagenwissenschaftliche und translationale Untersuchungen durch und erstellte ein Konzept für eine Professur, in der er die bariatrische Chirurgie mit der kompletten Chirurgie des oberen Gastrointestinaltrakt kombiniert. Damit entspricht dieses Tätigkeitsprofil der durch den Fachärzteverband der Europäischen Union UEMS (European Union of Medical Specialists) geforderten Subspezialisierung dieses Fachgebietes. „Die beiden Gebiete sind sowohl thematisch als auch operationstaktisch extrem verwandet und wir haben hier viele Überschneidungen“, erklärt der zweifache Vater.
„Die rekonstruktiven Schritte in der Krebschirurgie ähneln denen in der bariatrischen Chirurgie.“ Wobei es hier herausfordernde Forschungsansätze gebe: „Während auf der einen Seite ein Gewichtsverlust das Ziel ist, möchte ich das auf der anderen Seite, bei den Krebskranken, verhindern.“ Und eben das sei das Hochspannende an seiner Arbeit: „Ich kann ein anatomisches Gebiet sowohl funktionell als auch onkologisch und metabolisch betrachten. Ich muss alles von unterschiedlichen Seiten angehen, um Probleme zu erkennen und zu lösen und für jede Situation gerüstet sein.“ Die zu beherrschenden operativen Plattformen schließen zudem alle gängigen und hochmodernen Technologien ein. Seyfried und sein Team operieren konventionell chirurgisch offen sowie minimal-invasiv, also endoskopisch mit Sonde und laperoskopisch mit Schlüssellochtechnologie, auch unter Anwendung von komplexen OP-Systemen wie den Operationsroboter.
Multimodale Therapieansätze bei Adipositas analog zur Krebsbehandlung
In der Adipositas-Therapie gibt es inzwischen infolge der zahlreichen neuen Erkenntnisse zur Wirkweise von bariatrischen Operationen auch Analogien zur multimodalen Krebstherapie. So könnten stark Übergewichtige von Medikamenten profitieren, die sich verstärkt auf den Metabolismus auswirken und diesen dazu bringen, relevant Gewicht zu verlieren. Diese imitieren nunmehr die komplexen Wirkungsweisen der Adipositas-Operation. So ändern sich über eine chirurgische Veränderung der Anatomie komplexe Regelkreise, deren Wirkung sehr wesentlich über Strukturen im Gehirn vermittelt wird. Dies hat Seyfried gerade erst gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der Würzburger Endokrinologie, der Psychiatrie und der Molekularen Infektionsbiologie publiziert. Ist der Hypothalamus, ein zentraler Teil des Gehirns, der als wichtige Schaltzentrale unseres Körpers vegetative und endokrine Vorgänge reguliert und unter anderem die Nahrungsaufnahme steuert, krankheitsbedingt zerstört, ist der Effekt der Operation deutlich abgeschwächt. Denn sattmachende Hormone, die nach dem chirurgischen Eingriff verstärkt aus dem Magen-Darm-Trakt ausgeschüttet werden, können ihre nahrungsregulierende Wirkung über den geschädigten Hypothalamus nicht entfalten.
Seyfried hofft sehr, dass er mit solchen Erkenntnissen dazu beitragen kann, sowohl seine Patientinnen und Patienten als auch die Adipositas-Chirurgie vom Stigma zu befreien. Diätetische Maßnahmen funktionieren bei den meisten Patienten nicht. Der Körper habe beim Gewichtsverlust klare Verteidigungsstrategien, um den Hungertod abzuwenden. Dabei könne er nicht unterscheiden, ob ich 5 Kilogramm zu viel habe und diese eine sinnvolle Reserve sind, oder ob ich 50 Kilogramm zu viel habe und dieses Übergewicht mich todkrank macht. Adipositas ist eine Krankheit, die interdisziplinär mit individuell abgestimmten multimodalen Therapieansätzen behandelt werden kann.
Ausbau des klinischen Sektors in der metabolisch bariatrischen Chirurgie
Florian Seyfried hat sich für seine Professur viel vorgenommen. Die metabolisch bariatrische Chirurgie, mit der die Universitätsmedizin Würzburg deutschlandweit schon sehr präsent sei, möchte er weiter ausbauen und sowohl die Betroffenen als auch die bariatrische Chirurgie vom Stigma befreien. „Wir sind translational bereits sehr stark aufgestellt, nun gilt es, mit diesen Ansätzen den Weg in die klinische Forschung zu finden und unsere geplanten multizentrischen, prospektiv, randomisierten Studien umzusetzen,“ erklärt er.
Aufbau eines Registers für seltene Schluckbeschwerden im Achalasie-Zentrum
Ein weiterer Forschungsfokus liegt auf der Achalasie. Würzburg hat sich zu einem von drei großen Zentren in Deutschland entwickelt, die diese seltene aber schwerwiegende Funktionsstörung der Speiseröhre (lateinisch Ösophagus) behandelt. Die Betroffenen haben Probleme beim Schlucken und stoßen Unverdautes wieder auf. Im „Zentrum für Achalasie und andere Ösophagusmotilitätsstörungen“, das er unter dem Dach des Zentrums für Seltene Erkrankungen (ZESE) leitet, werden etwa 100 Patientinnen und Patienten pro Jahr behandelt. Oft reicht schon eine Schwächung des Schließmuskels zwischen Speiseröhre und Magen, um die Speiseröhre zu entleeren. Die Betroffenen haben einen langen Leidensweg hinter sich, bevor ihre Erkrankung überhaupt diagnostiziert wird. Die Symptome sind unspezifisch, die Ursachen unklar und daher ist die Erkrankung noch weitestgehend unverstanden. Doch das will Florian Seyfried mit seinem Team ändern. „Aus den Daten, die wir bereits von 800 Patientinnen und Patienten gesammelt haben, möchten wir ein Register erstellen und retrospektiv auswerten, aber auch fortsetzen, um mehr Erkenntnisse zur Entstehung und Behandlung zu erhalten.“ Des Weiteren möchte er den Stellenwert vielversprechender moderner minimaler Operationstechniken, wie der robotischen Chirurgie, zur operativen Behandlung onkologischer Erkrankungen von Magen und Speiseröhre systematisch untersuchen. Florian Seyfried steckt voller Tatendrang und seine Faszination vom „Upper GI“, wie sein Fachgebiet in europäischen Kollegenkreisen kurz und prägnant beschreiben, kommt selbst dann zum Ausdruck, wenn er sich nach einer nächtlichen Notoperation eines komplizierten Speiseröhrenrisses und klinischem Alltag am späten Nachmittag mit einem Espresso für die nächste Besprechung rüstet.