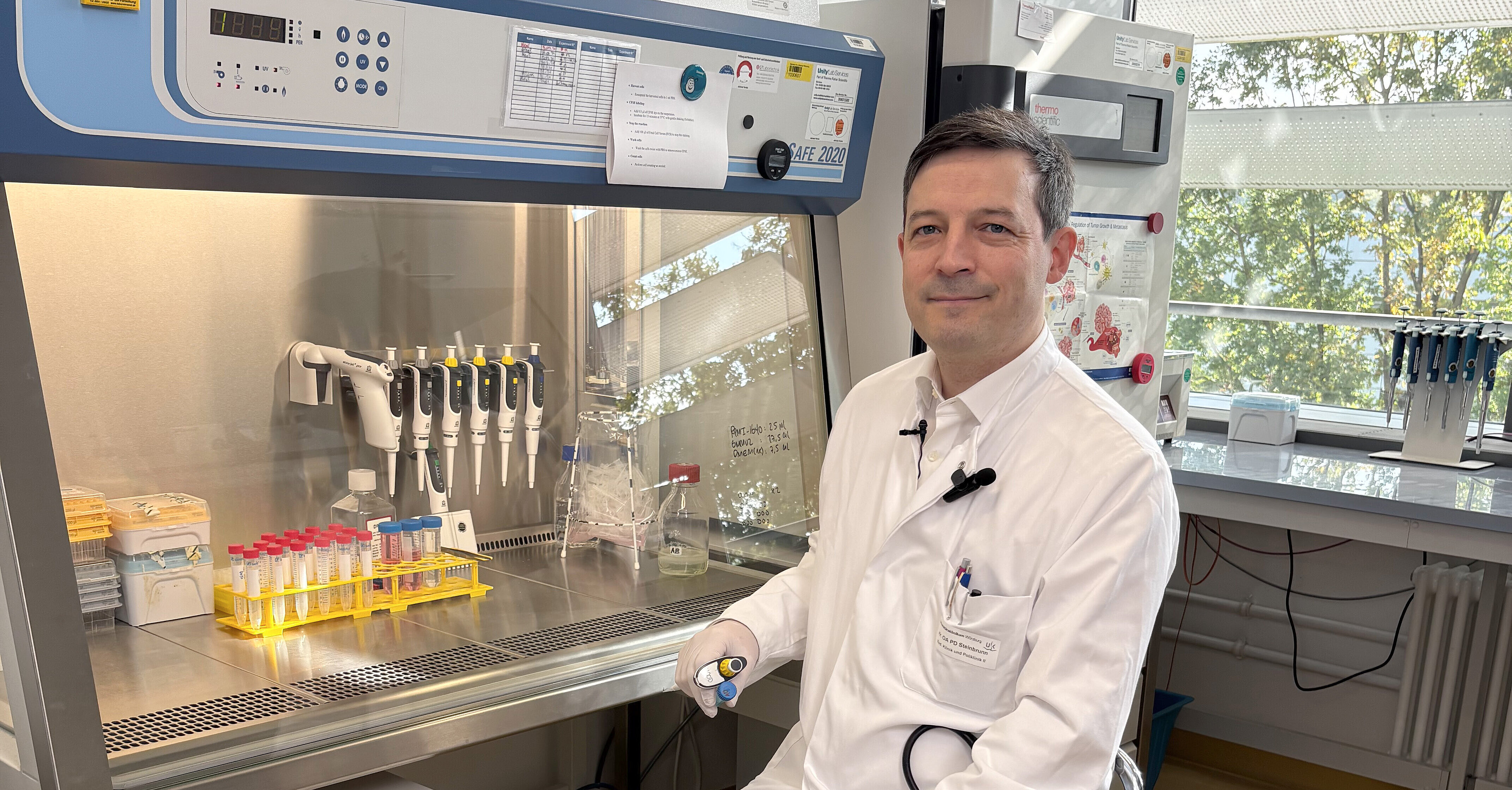Seit acht Jahren trägt „Forschung hilft“, die Stiftung zur Förderung der Krebsforschung am Universitätsklinikum Würzburg (UKW), erfolgreich Spendengelder zusammen, um damit möglichst viele vielversprechende onkologische Forschungsprojekte zu unterstützen. Am 20. November 2025 wurden bei einem Festakt Preisgelder in Höhe von insgesamt fast 235.000 Euro an 21 Würzburger Forschungsgruppen verteilt.
Mit 20.000 Euro ging die höchste Fördersumme des Abends an die AG Steinbrunn aus dem Bereich der Medizinischen Klinik und Poliklinik II. Insgesamt wurden im Bereich der Med II zwölf Forschungsgruppen unterstützt, die zusammen Preisgelder in Höhe von über 146.000 Euro erhielten.
AG Steinbrunn: 20.000 Euro für die „Untersuchung der RAS-Inhibition als zielgerichtete Behandlungsoption gegen das Multiple Myelom“
Privatdozent Dr. med. Dr. rer. nat. Torsten Steinbrunn möchte gemeinsam mit seiner Arbeitsgruppe neue Therapieansätze gegen das Multiple Myelom entwickeln. Da viele Myelomzellen das onkogen mutierte RAS aufweisen, wird er den Einsatz von RAS-Inhibitoren, also Medikamenten, die das RAS-Protein gezielt hemmen, untersuchen.
In früheren Arbeiten konnte bereits gezeigt werden, dass solche Inhibitoren das Wachstum von Myelomzellen in Labor- und Tiermodellen bremsen. Im aktuellen Projekt werden primäre Myelomzellen von Patientinnen und Patienten mit und ohne KRAS- oder NRAS-Mutationen getestet, um das Ansprechen auf eine RAS-Inhibition zu bestimmen. Gleichzeitig wird der Einfluss des Knochenmark-Mikromilieus untersucht. Parallel dazu wird Torsten Steinbrunn eine neue Methode der funktionellen Genomik etablieren, die er während seines dreijährigen Forschungsaufenthalts in Boston kennengelernt hat. Mithilfe von CRISPR-Screens kann er erforschen, welche Gene zur Resistenz gegenüber RAS-Inhibitoren beitragen. Dabei sollen Kombinationstherapien gefunden werden, die Resistenzmechanismen überwinden. Das Projekt zielt somit sowohl auf eine neue zielgerichtete Therapie beim Myelom als auch auf ein tiefes Verständnis möglicher Resistenzstrategien ab, um die Wirksamkeit langfristig zu sichern.
Details zum Projekt auf der Seite Forschung hilft.
AG Rasche (Mildred-Scheel-Nachwuchszentrum): 19.000 Euro für das Projekt „Chemotherapie-induzierte Thymusschädigung und ihre Konsequenzen“
Das internationale Team von Professor Dr. Leo Rasche untersucht im geförderten Projekt die Auswirkungen klassischer Chemotherapien auf den Thymus, ein zentrales Organ für die Reifung von T-Zellen. Diese sind wiederum für den Erfolg nachfolgender Immuntherapien wichtig. Der Fokus liegt auf Arzneimitteln, die beim Multiplen Myelom eingesetzt werden, darunter Proteasom-Inhibitoren, Steroide und Alkylanzien. Erste Daten deuten darauf hin, dass Subtypen naiver T-Zellen, die sich besonders gut für CAR-T-Therapien eignen, durch Medikamente wie Melphalan oder Carfilzomib stark geschädigt werden. Deshalb untersucht das Projekt verschiedene T-Zell- und Thymuszellpopulationen nach einer Chemotherapie, um festzustellen, ob es besonders empfindliche Zellgruppen gibt, die sich nicht mehr erholen. Zur Analyse nutzt das Team moderne Methoden: Sie messen Veränderungen mit Durchflusszytometrie, analysieren die Genexpression mittels Bulk-RNA-Sequenzierung und erforschen metabolische Anpassungen der Zellen mithilfe eines Seahorse-Analyzers. Darüber hinaus setzen sie die räumliche Transkriptomik ein, um humane Thymus-Organoide zu untersuchen, die mit Chemotherapeutika behandelt wurden. So können sie gezielte toxische Effekte in verschiedenen Regionen des Thymus nachweisen.
Details zum Projekt auf der Seite Forschung hilft.
AG Kunzmann: 15.000 Euro für die „Prädiktive Immuntherapie-Biomarker Analyse solider Tumore (Solid Flow)“
Die Immuntherapie hat die medikamentöse Tumortherapie revolutioniert. Allerdings haben bislang nicht alle Krebspatienten zeitnah Zugang zu dieser neuen Therapieform. Das Hauptziel des Projekts der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Volker Kunzmann besteht daher darin, eine neue patientennahe Sofortdiagnostik (POCT) für immuntherapie-relevante prädiktive Biomarker zu etabliere, also eine Diagnostik, die direkt im klinischen Alltag genutzt werden kann und schnell vor Therapiebeginn Ergebnisse liefert.
Bei vielen soliden Tumoren (z. B. Lungenkrebs, Darm-, Magen-, Blasen- und Kopf-Hals-Karzinome sowie triple-negativer Brustkrebs) wird heute vor einer Immuntherapie geprüft, ob bestimmte „Biomarker” vorhanden sind. Diese Biomarker – meist Proteine auf Tumorzellen oder immunaktiven Zellen im Tumor – zeigen an, ob eine Immuncheckpoint-Blockade (ICB) voraussichtlich wirken kann. Bisher wird diese Analyse meist als Immunhistochemie mit klassischen Gewebeschnitten durchgeführt: Das dauert mehrere Tage und ist relativ aufwendig.
Das Projekt „Solid Flow“ will stattdessen eine neue Methode einführen, die auf Durchflusszytometrie (Flow-Zytometrie) basiert, um diese prädiktiven Immun-Biomarker direkt aus frisch entnommenen Tumorproben zu messen – und das innerhalb von ein bis zwei Stunden nach der Biopsie. Mit dem Verfahren können bis zu zwölf verschiedene Biomarker gleichzeitig analysiert werden. Auch tumorinfiltrierende Immunzellen können bestimmt werden. Selbst sehr kleine Biopsien können untersucht werden.
Langfristig erhofft sich das Projekt, durch diese neue Methode neue prädiktive Biomarker zu identifizieren, die heute noch nicht standardmäßig untersucht werden, und somit die Auswahl der Patientinnen und Patienten für eine Immuntherapie deutlich zu verbessern. So könnten mehr Patientinnen und Patienten von der Immuntherapie profitieren, während anderen, bei denen eine Wirkung unwahrscheinlich ist, unnötige Nebenwirkungen erspart bleiben.
Das Projekt soll insgesamt dazu beitragen, die Krebstherapie individueller, effizienter und zielgerichteter zu machen – und zwar für viele verschiedene Arten solider Tumoren.
Details zum Projekt auf der Seite Forschung hilft.
AG Kraus: 15.000 Euro für die „Analyse der RSV-Impfantwort bei Krebspatienten zur gezielten Verbesserung der Schutzwirkung“
Die Arbeitsgruppe von Priv.-Doz. Dr. med. Sabrina Kraus beschäftigt sich mit dem spannenden und hochaktuellen Thema der Immunantwort auf Impfungen bei hämatologischen Patientinnen und Patienten.
In dem geförderten Forschungsprojekt wird untersucht, wie gut Krebspatientinnen und -patienten, insbesondere nach einer allogenen Stammzelltransplantation (alloSZT) oder bestimmten Immuntherapien, auf eine Impfung gegen das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) reagieren. Diese Patientinnen und Patienten haben häufig ein geschwächtes Immunsystem, wodurch sie besonders anfällig für schwere RSV-Infektionen sind, die bei ihnen lebensgefährlich verlaufen können.
Trotz inzwischen zugelassener RSV-Impfstoffe fehlen verlässliche Daten zur Wirksamkeit bei Hochrisikopatienten. Ziel der Arbeit ist es, die Immunantwort auf eine RSV-Impfung bei Krebspatienten mit eingeschränktem Immunsystem im Vergleich zu gesunden Personen zu analysieren. Das Team analysiert sowohl die humorale (also die Antikörper-) als auch die zelluläre Immunantwort im Blut – und zwar vor der Impfung, sechs Wochen später, nach sechs Monaten und nach zwei Jahren. Dabei werden unterschiedliche Einflussfaktoren berücksichtigt. Zusätzlich sollen Biomarker identifiziert werden, mit denen sich Patientinnen und Patienten, deren Immunantwort auf die Impfung schwach ist, schon frühzeitig erkennen lassen. Daraus sollen Maßnahmen abgeleitet werden, wie sich der Impfschutz bei diesen besonders gefährdeten Personen verbessern lässt – etwa durch angepasste Impfpläne oder Nachimpfungen. Insgesamt soll das Projekt dazu beitragen, das Infektionsrisiko durch RSV bei dieser besonders gefährdeten Patientengruppe nachhaltig zu senken.
Details zum Projekt auf der Seite Forschung hilft.
AG Maatouk und Teschner: 10.000 Euro für das Projekt „TransplantVR – VR-gestützte Intervention zur Reduktion von Belastungen bei Stammzelltransplantation“
Prof. Dr. Imad Maatouk, Inhaber des Lehrstuhls für Integrierte Psychosomatische Medizin, und PD Dr. Daniel Teschner, Leiter des Zentrums für allogene Stammzelltherapien, wollen mit ihrem Projekt „TransplantVR” eine digitale, niederschwellige Unterstützung für Patientinnen und Patienten schaffen, die eine allogene Stammzelltransplantation erhalten. Das Ziel besteht darin, diese besonders belastende und oft angstbesetzte Phase der Krebstherapie erträglicher zu machen.
Zu diesem Zweck wird erstmals eine Virtual-Reality-(VR)-Anwendung entwickelt, die psychoedukative Inhalte mit Entspannungs- und Angstreduktion kombiniert. Über eine VR-Brille erhalten die Betroffenen beispielsweise Informationen über den Ablauf der Behandlung, mögliche Nebenwirkungen und deren Behandlung sowie Strategien zur Stressbewältigung. Außerdem gibt es entspannende virtuelle Umgebungen, zum Beispiel Naturerlebnisse, sowie Übungen zur emotionalen Stabilisierung und Selbstwirksamkeit.
Das Ziel besteht darin, mithilfe dieser VR-gestützten Intervention Ängste und psychische Belastungen im Zusammenhang mit der Stammzelltransplantation zu verringern und die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten zu verbessern. Die Inhalte werden gemeinsam mit Betroffenen, Pflegekräften sowie psychosozialen Expertinnen und Experten entwickelt, um sicherzustellen, dass sie eine realistische Unterstützung bieten. In einer Pilotstudie soll geprüft werden, ob die Anwendung praktikabel ist und erste Hinweise auf ihre Wirksamkeit liefert.
Details zum Projekt auf der Seite Forschung hilft.
AG Lang: 8.000 Euro für das Projekt „Der Rezeptor ROR2 – Angriffsziel für therapeutische Antikörper“
Die Arbeitsgruppe von Dr. Isabell Lang ist der Abteilung für Molekulare Innere Medizin unter der Leitung von Prof. Dr. Wajant zugeordnet und befasst sich mit der Entwicklung von „therapeutischen Fusionsproteinen und Antikörpern“. Das Ziel besteht darin, spezielle Signalmoleküle, sogenannte Rezeptoren, zu nutzen, um Tumorzellen gezielt zu bekämpfen. In dem geförderten Forschungsprojekt geht es um den Zelloberflächenrezeptor ROR2, der bei verschiedenen Krebsarten, wie etwa Multiples Myelom, Brust- oder Bauchspeicheldrüsenkrebs, stark übermäßig produziert wird, während er in normalen erwachsenen Geweben kaum vorkommt. Das macht ihn zu einem guten „Marker“, mit dem sich Krebszellen von gesunden unterscheiden lassen.
Das Ziel des Projekts ist die Entwicklung multispezifischer Antikörper-Fusionsproteine: Diese binden über eine Domäne an ROR2 auf Krebszellen und über eine oder mehrere weitere Domänen an bestimmte Rezeptoren des Immunsystems (z. B. TNF-Rezeptoren). Dadurch soll die Immunantwort genau dort aktiviert werden, wo sie benötigt wird, nämlich im Tumor, und nicht im ganzen Körper. So könnten Nebenwirkungen geringer ausfallen und die Therapie sicherer und effektiver werden.
Ein alternativer Ansatz sieht vor, ROR2 direkt mit blockierenden Antikörpern zu hemmen. Bei bestimmten Krebsarten kann dies die Verbindung von Tumorzellen mit ihrer „schützenden Umgebung“ stören, beispielsweise im Knochenmark beim Multiplen Myelom, und so das Überleben der Krebszellen gefährden.
Details zum Projekt auf der Seite Forschung hilft.
AG Weich: 8.000 Euro für das Projekt „Lebensqualität im Fokus – Prospektive Erfassung bei neuroendokrinen Tumoren“
PD Dr. Alexander Weich ist Leiter des Zentrums für neuroendokrine Tumoren (NET) am UKW (ENETS CoE) und betreut dort Patienten mit neuroendokrinen Tumoren. Ziel seines Projekts ist die systematische und prospektive Erfassung der Lebensqualität dieser Patientinnen und Patienten. Diese seltenen, meist langsam wachsenden Tumoren können im gesamten Körper entstehen, vor allem im Magen-Darm-Trakt, in der Lunge und in der Bauchspeicheldrüse. Mithilfe regelmäßiger digitaler Befragungen werden Symptome, Belastungen und Veränderungen im Befinden erfasst, um Therapien individuell anzupassen. So können Nebenwirkungen früh erkannt und Behandlungen besser vertragen werden. Langfristig sollen die erhobenen Daten helfen, Therapieabläufe evidenzbasiert zu optimieren, um neben der Wirksamkeit der Behandlung auch die Lebensqualität der Betroffenen bestmöglich zu erhalten.
Details zum Projekt auf der Seite Forschung hilft.
AG Shaikh: 8.000 Euro für das Projekt „Neue Leukämietherapie durch gezielte Aktivierung von iNKT-Zellen über TNF-Rezeptoren“
Die Nachwuchsgruppe von Dr. Muhammad Haroon Shaikh erforscht, wie Krebszellen mit ihrer Umgebung kommunizieren und wie sich das Immunsystem gezielt gegen den Tumor aktivieren lässt. Im Rahmen dieses Projekts entwickelt das Team eine neue Form der Immuntherapie gegen akute myeloische Leukämie (AML). Dabei stehen invariante natürliche Killer-T-Zellen (iNKT) im Mittelpunkt. Diese Immunzellen erkennen und zerstören Krebszellen. Das Forschungsteam stärkt die iNKT-Zellen, indem es ihre TNF-Rezeptoren gezielt beeinflusst. So sollen die Zellen aktiver werden, Leukämiezellen bekämpfen und die Immunantwort länger aufrechterhalten. Das Ziel besteht darin, die iNKT-Zellen so zu stärken, dass sie das von der Leukämie geschaffene hemmende Umfeld durchbrechen können. Damit wollen die Forschenden den Grundstein für neue, sichere und wirksame Behandlungen legen – nicht nur bei AML, sondern auch bei anderen Krebsarten.
Details zum Projekt auf der Seite Forschung hilft.
AG Löffler und Henniger: 8.000 Euro für „SaRKo-GI: Sarkopenie Risikoscreening bei Krebserkrankungen des oberen Gastrointestinaltraktes“
Die Überlebenschancen von Patienten mit gastrointestinalen Tumoren haben sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Gleichzeitig sind bis zu 80 % von einer erkrankungsbedingten Mangelernährung und Muskelschwund (Sarkopenie) bedroht. Dies kann sich nachteilig auf die Therapieverträglichkeit und die Prognose auswirken. Das interdisziplinäre Team der Arbeitsgruppe unter der Leitung von PD Dr. med. Claudia Löffler und Dr. med. Dorothea Henniger arbeitet im Rahmen des SaRKo-GI-Projekts gemeinsam mit Dr. Henner Huflage, dem Leiter der Computertomografie der Radiologie, und PD Dr. med. Alexander Weich, dem Leiter des ENET-Zentrums, an innovativen Konzepten. Diese sollen es ermöglichen, Patientinnen und Patienten mit einem Höchstrisiko für die Entwicklung einer Sarkopenie frühestmöglich zu identifizieren und im Rahmen des Nutrition-Care-Prozesses leitliniengerecht zu behandeln.
In dieser Studie sollen drei etablierte Methoden untersucht werden, um zu evaluieren, wie Ernährungsrisiken mit einer hohen Zuverlässigkeit und Genauigkeit möglichst früh erkannt werden können. Das Ziel besteht darin, durch die zeitnahe Einleitung einer ernährungsmedizinischen Intervention die Chancen für einen optimalen Krankheitsverlauf zu verbessern.
Details zum Projekt auf der Seite Forschung hilft.
AG Hermanns: 8.000 Euro für „Neue Angriffspunkte im zellulären Energiestoffwechsel zur Therapie von Leberkrebs“
Um gegenüber normalen Zellen einen Wachstumsvorteil zu erlangen, verändern Tumorzellen häufig ihren Stoffwechsel. Dabei können jedoch schädliche Nebenprodukte entstehen, die die Tumorzelle durch die verstärkte Expression von Reparaturenzymen abbaut. Die Hemmung dieser Enzyme könnte daher ein vielversprechender neuer Ansatzpunkt zur Eindämmung des Tumorwachstums sein. In diesem Projekt untersucht die Arbeitsgruppe von PD Dr. rer. nat. Heike Hermanns die Konsequenzen der Hemmung des Enzyms Phosphoglykolat-Phosphatase durch einen neu entwickelten Inhibitor von Kollaborationspartnern (AG Gohla, Pharmakologie) in Leberkrebszellen. Die erhöhte Expression dieses Reparaturenzyms korreliert nämlich nachweislich mit einem geringeren Überleben von betroffenen Patientinnen und Patienten.
Das Forschungsprojekt soll dazu beitragen, die Behandlung von metabolisch bedingtem, therapieresistentem Leberkrebs zu verbessern. Diese Tumorart nimmt weltweit leider stark zu und besitzt aktuell nur begrenzte Therapieoptionen.
Details zum Projekt auf der Seite Forschung hilft.
AG Tabares und Beilhack: 8.000 Euro für das Projekt „Die Rolle der Glukosetransporter für die Prognose und Therapie des Multiplen Myeloms“
Das Multiple Myelom ist eine aggressive Form von Blutkrebs. Bösartige Plasmazellen dringen ins Knochenmark ein und können Organschäden verursachen. Trotz moderner Immuntherapien wie monoklonalen Antikörpern, BiTEs oder CAR-T-Zellen bleibt das Myelom meist unheilbar und der Krankheitsverlauf unterscheidet sich stark von Patient zu Patient. Insbesondere Menschen mit Hochrisikoformen oder extramedullärer Erkrankung haben oft eine schlechte Prognose, da die Krankheit schnell voranschreitet und gegen aktuelle Therapien resistent sein kann. Deshalb suchen wir dringend nach neuen Prognosemarkern und innovativen Therapieansätzen, um die Behandlungsergebnisse nachhaltig zu verbessern. In diesem Projekt untersuchen Dr. Paula Tabares und Prof. Dr. Dr. Andreas Beilhack mit ihrem Team die Rolle des Glukosetransporters für die Prognose und Therapie des Multiplen Myeloms.
Der Glukosetransporter 1 (GLUT-1) ermöglicht es Körperzellen, Energie in Form von Glukose aufzunehmen. Je mehr GLUT-1 in einer Zelle vorhanden ist, desto mehr Energie benötigt die Zelle und desto aktiver ist sie. Krebszellen teilen sich schnell und benötigen besonders viel Energie. Deshalb bilden sie in der Regel mehr GLUT-1-Transporter als gesunde Zellen. Beim Multiplen Myelom stehen die bösartigen Plasmazellen im Blut und Knochenmark im Mittelpunkt der Forschung. Die Forschenden vergleichen daher die GLUT-1-Dichte in gesunden und bösartigen Plasmazellen. Sie untersuchen, wie sich diese Dichte im Krankheitsverlauf verändert und welchen Einfluss sie auf die Prognose hat. Zudem wird geprüft, ob sich GLUT-1 als Ansatzpunkt für neue Therapien eignet.
Details zum Projekt auf der Seite Forschung hilft.
Mildred-Scheel-Nachwuchszentrum
AG Riedel: 19.161 Euro für die „Verbesserung der Immuntherapie durch gezielte Manipulation von Lymphknoten-Makrophagen“
Die Arbeitsgruppe von Dr. Angela Riedel am Mildred-Scheel-Nachwuchszentrum für Krebsforschung befasst sich mit der zellulären Kommunikation von Krebszellen innerhalb ihrer Nische, also ihrer unmittelbaren Umgebung. Dazu gehört auch der tumor-drainierende oder Sentinel-Lymphknoten, da er dem Tumor direkt nachgeschaltet ist. Ein Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung der Auswirkungen von Tumortherapien auf die Nische und der Frage, wie diese zu Therapieresistenzen beitragen können. Im Rahmen dieses Projekts untersucht die Nachwuchswissenschaftlerin Ana Cetkovic (Doktorandin in der AG Riedel) die Mechanismen, die zur Resistenz gegen Immun-Checkpoint-Inhibitoren bei Melanom- und Brustkrebspatienten beitragen. Dabei arbeitet das internationale Team eng mit der Klinik und Poliklinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie, Arbeitsgruppe Prof. Dr. Astrid Schmieder, sowie mit der Frauenklinik, Leitung Prof. Dr. Wöckel, zusammen. Die Forschenden gehen davon aus, dass ein zielgerichteter Ansatz – insbesondere die Reprogrammierung der Lymphknoten-Makrophagen durch sogenannte Lipid-Nanopartikel in Kombination mit einer Anti-PD1-Immuntherapie – das Ansprechen der Patientinnen und Patienten verbessern könnte.
Details zum Projekt auf der Seite Forschung hilft.